Wir sind Höngg
Gedanken auf der Hohenklingenallee
Sie lebt in Höngg und war einst auf den Bühnen dieser Welt zu Hause: Elisabeth Promonti. Heute blickt sie auf eine Karriere als Opernsängerin, Musikpädagogin und Managerin für junge Gesangstalente der Oper zurück.
24. Oktober 2025 — Daniel Diriwächter
Mein Name lautet Erzsébet Amalia Katalin Maria Mladonyiczki. Aber man kennt mich als Elisabeth Promonti. Erraten Sie meine Nationalität? Polnisch? Oder vielleicht italienisch? Nein, ich bin Ungarin und meine Geburtsstadt Budapest ist zweigeteilt von der Donau: links die flache Ebene namens Pest, rechts das hügelige Buda.
Dort im Süden lag einmal ein Weinhügel, dessen Rebstöcke der Reblaus zum Opfer fielen. Aber der Hügel blieb und sein Name ist Promontor – heute Budafok-Tétény. Dort bin ich aufgewachsen, im Schatten von Mandel- und Aprikosenbäumen.
Mütterlicherseits stamme ich aus der Familie des Unternehmers Sándor Hollo aus Südungarn. Er besass Weingüter und zog wegen der Heirat nach Leva, heute Levice, in die Slowakei. Sein Schwiegersohn war der Ingenieur Eugen Csorba, mein Grossvater.
Er führte das Werk von Hollo weiter, baute für die Stadt ein Elektrizitäts- und ein Wasserkraftwerk, die beide bis heute in Betrieb sind. Bei meinem kürzlichen Besuch dort stellte ich fest, dass mein Grossvater bis heute als Wohltäter wahrgenommen wird, da er viel in die Stadtentwicklung investierte.
Meine Mutter war die ungarische Malerin Katalin Csorba, und die schönen Künste spielten bei uns eine grosse Rolle. Ich erhielt ab meinem sechsten Lebensjahr Klavierunterricht. Nach dem Abitur studierte ich auf Empfehlung meines Mentors, Professor Dénes Bartha, Chorleitung und Schulmusik an der Franz-Liszt-Musikhochschule und schloss 1965 mit Diplom ab. Gleichzeitig liess ich mich privat im Sologesang von Zoltán Zavodszky unterrichten und lernte das Orgelspiel beim Franziskaner Organisten Ferenc Gergely.
Ein neuer Name
Im Herbst 1965 begab ich mich auf eine Reise nach Salzburg und sang am Mozarteum Salzburg vor. Mit Erfolg: Ich wurde in die Opernklasse – geleitet von KS Viorica Ursuleac, die erste «Arabella» von Richard Strauss – aufgenommen und erhielt ein Rotary-Stipendium. Das hatte jedoch Konsequenzen: Da dieses Vorsingen nicht über das Ministerium lief, konnte ich nicht mehr nach Ungarn zurückkehren. Das fiel mir sehr schwer, doch ich hatte ein klares Ziel vor Augen: Ich wollte auf die Bühne.
Damals in Salzburg erhielt ich nach einem Konzert folgende Kritik: «Die Sängerin mit der schönen Stimme, aber mit dem unaussprechlichen Namen.» Nach reichlichen Überlegungen wählte ich den Namen Promonti – in Anlehnung an den Weinhügel Promontor, meiner Heimat.

Zwei Jahre später schloss ich meine Bühnenausbildung mit Auszeichnung ab und wurde beim Stadttheater Bielefeld engagiert. Dort debütierte ich als «Aida», sogar in der italienischen Originalsprache. Wenig später sprang ich mit dieser Rolle auch in Bremen ein. Es folgten weitere Rollen: Elsa in «Lohengrin», Pamina und Erste Dame in «Die Zauberflöte», Frau Fluth in «Die lustigen Weiber von Windsor» und viele andere.
Und so führte mich mein Weg im Jahr 1970 auch nach Zürich. Ich meldete mich beim Internationalen Opernstudio des Opernhauses Zürich, mit dem Ziel, den Wechsel ins Mezzofach zu vollbringen. Meine Stimme umfasste drei Oktaven, und besonders interessierte mich die szenische Rollengestaltung im tiefen Stimmbereich. Unterstützt wurde ich dabei vom Generalmusikdirektor und Dirigenten Ferdinand Leitner sowie von Maestro Nello Santi.
Ein Zuhause in Höngg
Das Engagement liess mir Raum für Privates: Ich heiratete und 1973 wurde mein Sohn Michael geboren. Unser Zuhause wurde Höngg. Ich erinnere mich an die gemeinsamen Spaziergänge auf der Hohenklingenallee. Aber das Leben hielt Veränderungen bereit: Meine Ehe ging auseinander, 1975 folgte die Scheidung.
Im selben Jahr wechselte auch die Direktion am Opernhaus Zürich. Ein Vertragsangebot lehnte ich ab, da mir mit keiner der angebotenen Rollen künstlerische Perspektiven zugesichert wurden und ich mit dem aufkommenden Regietheater nicht übereinstimmte.
Ich konzentrierte mich auf die Pädagogik und wechselte nach Luzern an die Kantonsschule. Mit dem Pianisten Gilbert de Greeve gab ich Liederabende in vielen Ländern von Europa, in den USA und in Kanada. Später gründete ich das Schweizerische Kodály Institut, basierend auf dem Konzept des ungarischen Komponisten Zoltán Kodály.
Unsere Ehrenpräsidenten waren Yehudi Menuhin und Sándor Veress. Ich schrieb nach diesem Konzept auch ein Lehrbuch, das auf deutschsprachigen Volksliedern beruhte. Wegen fehlender finanzieller Unterstützung musste das Institut nach zehn Jahren seine Arbeit einstellen.
Engagement mit meinem Sohn
Auch das Leben meines Sohnes Michael Sauser prägte meinen Weg. Er studierte Jura an der Universität Zürich, das er 1998 erfolgreich mit Lic. iur. abschloss. Seine sonstigen Interessen galten dem Reisen, dem Gesang und dem Fussball. Dadurch lernte er die Nationalhymnen der Welt kennen. Zudem hatte er Kontakt mit dem damaligen IOC-Präsidenten Juan Antonio Samaranch.
1998 trat er im Olympischen Museum Lausanne mit einem «Hymnen-Marathon» auf, bei dem er alle Nationalhymnen der Welt auswendig und in Originalsprache vortrug. Dafür erhielt er die Anerkennung eines Guinness-Rekords. Später nahm er fünf Alben mit sämtlichen Nationalhymnen in Originalsprache auf. Es folgten Auftritte in Fernsehsendungen wie «Wetten, dass..?» in Frankfurt, wo Michael zum Wettkönig gewählt wurde.

In den 1990er-Jahren gründeten mein Sohn, der sieben Sprachen fliessend beherrschte, und ich das Concorde Opera Management. Unser Ziel war es, jungen Sängerinnen und Sängern sowie Dirigenten den Einstieg in das anspruchsvolle Berufsleben zu ermöglichen und wir standen im Kontakt zu grossen und kleinen Bühnen weltweit. Wir hatten noch vieles vor und waren ein gutes Team.
Doch das Schicksal schlug erbarmungslos zu: Michael starb im Jahr 2016 mit nur 42 Jahren an den Folgen eines Unfalls in Berlin. Nach seinem Tod kam ich wieder nach Zürich, und das Schicksal führte mich nach Höngg zurück. Seither widme ich mich dank meines Orgelstudiums und meiner noch gut funktionierenden Stimme mehrheitlich der Kirchenmusik; dem Singen sowie dem Orgel- und Klavierspiel.
Neben diesen Engagements bin ich viel auf Reisen, aber ich spaziere immer wieder die Hohenklingenallee entlang. Dabei denke ich an das, was war: an meine Familie und ihre lange Geschichte, an meine Gesangskarriere, an die vielen jungen Talente, auf die ich traf, und ganz besonders an Michael, den ich im Herzen immer bei mir trage. Aber ich geniesse auch das Hier und Jetzt und freue mich auf das, was noch kommen könnte.
Aufgezeichnet von Daniel Diriwächter

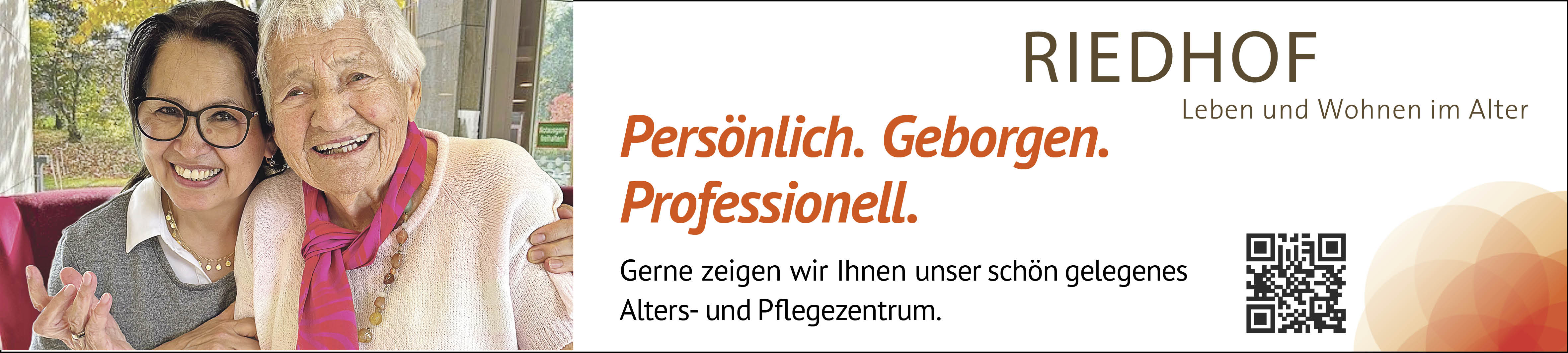


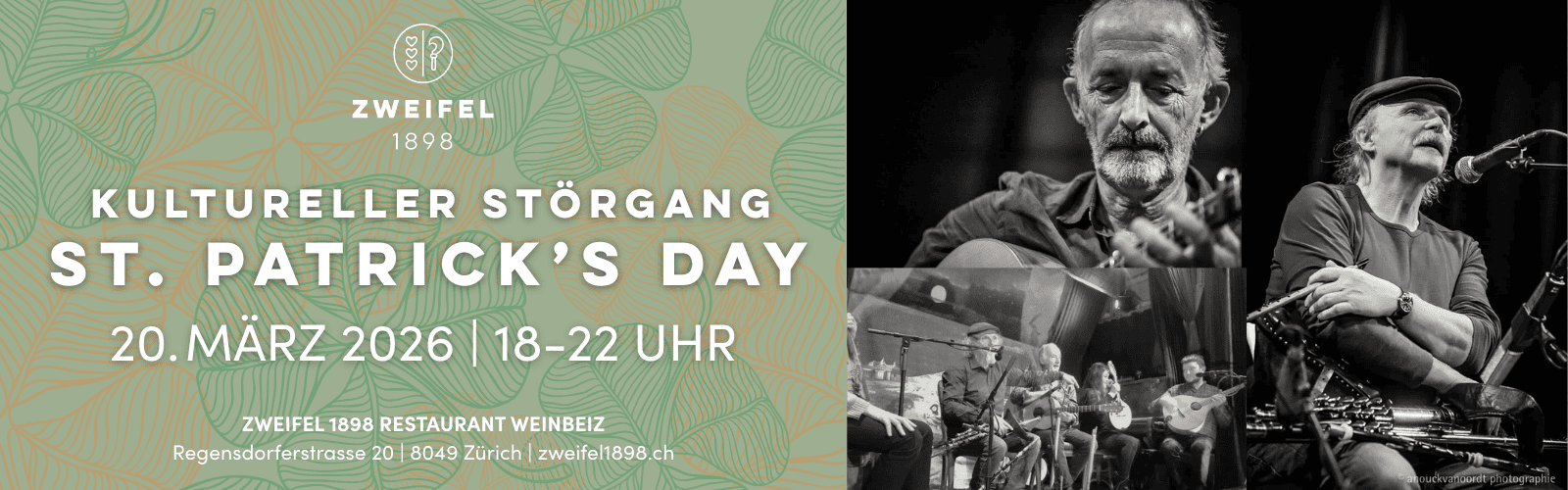
0 Kommentare