Gesundheit
Der Gemeine Holzbock und seine Kollegen
Mit diesen Lebewesen stehen viele auf Kriegsfuss: den Zecken. Sie stechen nicht nur, sondern können auch einige Krankheiten übertragen. Und im aktuell vorherrschenden feucht-warmen Wetter sind sie ganz besonders aktiv. Eine kleine Annäherung.
18. Juni 2024 — Dagmar Schräder
Über Schönheit lässt sich bekanntlich nicht streiten. Doch in Bezug auf Zecken herrscht in der Regel Einstimmigkeit: Es gibt wohl kaum jemanden, der für diese kleinen Spinnentiere aus der Gattung der Milben Sympathien aufbringen kann. Und wer bei sich oder seinen Haustieren einen dieser Parasiten entdeckt, die ihr Körpervolumen mit einer Blutmahlzeit um mehr als das Hundertfache vergrössern und so rund wie dicke, pralle Rosinen werden können, kann in der Regel einen gewissen Ekel nicht verbergen. Im Moment haben die Blutsauger zum Leidwesen von Mensch und Tier Hochkonjunktur: Der Frühsommer ist die zeckenintensivste Zeit des Jahres.
Warten und Blut saugen
Objektiv betrachtet ist die Lebensweise der Zecke jedoch ziemlich faszinierend: Ihr Lebenszyklus dauert drei bis sechs Jahre und beinhaltet lediglich drei Mahlzeiten. Rund 94 Prozent ihrer Lebenszeit verbringen die Spinnentiere damit, auf die nächste Mahlzeit zu warten. Dazu verharren sie auf Gräsern und im Unterholz in Bodennähe und werden von vorbeikommenden Tieren und Menschen abgestreift.
Die im Frühling schlüpfenden Zeckenlarven, nicht mal einen Millimeter gross, befallen für ihre erste Mahlzeit Kleinsäuger wie Mäuse oder Igel. Danach lassen sie sich abfallen, häuten sich und entwickeln sich zu achtbeinigen Nymphen, ein bis zwei Millimeter gross. Diese suchen sich einen weiteren Wirt. Nach ihrer zweiten Mahlzeit verlassen sie diesen und entwickeln sich zu adulten Tieren. Deren Beuteschema sind Säugetiere und Vögel, auf denen sie sich festsetzen und bis zu 14 Tage lang vollsaugen.
Hier findet auch die Partnerwahl statt: Die männlichen Zecken suchen auf den Wirtstieren nach einem Weibchen. Nach der Kopulation ist ihr Zweck erfüllt, sie sterben. Die Weibchen fallen nach der letzten Mahlzeit ab, prall gefüllt, bereit zur Eiablage. Die Eier werden im Boden abgelegt, danach sterben auch die weiblichen Tiere.
Weltweit existieren rund 850 verschiedene Zeckenarten. In der Schweiz gehören die meisten der anzutreffenden Individuen der Spezies des «Gemeinen Holzbocks» an.
Wenn der Stich krank macht
Befällt eine Zecke den Menschen, ist dies nicht nur lästig, sondern kann auch gefährlich werden. Dabei geht die Gefahr nicht vom Stich selber, sondern vielmehr von den damit übertragbaren Krankheiten aus. Hierzulande sind die beiden wichtigsten die Lyme-Borreliose sowie die Frühsommer-Meningo-Enzephalitits, kurz FSME. Dabei sind aber längst nicht alle Zecken Krankheitsüberträger: Schätzungsweise rund 5 bis 30 Prozent tragen die Bakterien des Borreliose-Erregers in sich. Daran erkranken nach Angaben des Bundesamtes für Gesundheit (BAG) hierzulande jährlich rund 10 000 Menschen. Die Borreliose lässt sich mit Antibiotika behandeln.
In Bezug auf FSME lassen sich Hotspots finden, an denen das Virus gehäuft vorkommt. In diesen Gebieten, so die Informationen der Zeckenliga, sind zwei bis drei Prozent der Zecken mit FSME infiziert, ausserhalb der Endemiegebiete sind es bis zu 0,5 Prozent der Zecken. Wird man von einer infizierten Zecke gestochen, folgt jedoch nicht zwangsläufig eine Erkrankung: «Die Infektion mit dem FSME-Virus kann manchmal ohne Symptome verlaufen, verursacht jedoch in 70 bis 80 Prozent der Infektionen eine grippeähnliche Erkrankung. In 20 bis 30 Prozent dieser Fälle folgt eine zweite Phase mit Befall des zentralen Nervensystems», erklärt das BAG dem «Höngger» auf Anfrage.
Insgesamt ist in den letzten Jahren, mit einigen Schwankungen, schweizweit eine Zunahme der Fallzahlen zu beobachten: Lag die Zahl im Jahr 2000 bei 82 Erkrankten, waren im Spitzenjahr 2020 bereits 409 Erkrankungen zu verzeichnen. 2023 betrug die Zahl 245.
Dieser Anstieg ist, so das BAG, «auf das veränderte Verhalten der Menschen sowie auf klimabedingte Veränderungen in der Umwelt zurückzuführen». So führen etwa mildere Winter zu einem früheren Erwachen der Tiere aus der Winterstarre und demzufolge auch zu einem früheren Expositionsrisiko. Gegen die FSME empfiehlt das BAG eine Schutzimpfung.
Und was ist mit den Haustieren?
Doch nicht nur der Mensch, auch unsere Haustiere können an den Folgen einer Zeckenbegegnung erkranken. Zwar treten FSME und Borreliose bei Hunden und Katzen im Vergleich zum Menschen eher selten auf, es finden sich jedoch andere von Zecken übertragene Krankheitserreger, die insbesondere für Hunde ein erhebliches Gesundheitsrisiko darstellen können. Dazu gehört die in der Schweiz vorkommende Babesiose.
Diese Krankheit wird durch Einzeller ausgelöst, welche sowohl durch die Braune Hundezecke als auch durch die Wiesenzecke übertragen werden. Eine Infektion mit der Babesiose kann bei Hunden schwerwiegende Erkrankungen hervorrufen. Allerdings, so lässt sich den Informationen der Vereinigung führender Veterinärparasitologen (ESCCAP) entnehmen, ist die Verbreitung der die Krankheit übertragenden Zecken lokal (noch) sehr beschränkt: Während die Hundezecke vornehmlich in Südeuropa anzutreffen ist, finden sich Babesien übertragende Wiesenzecken in lokal eng definierten Gebieten.
Anders als Hunde sind Katzen hierzulande nicht von Babesiose betroffen. Sie erkranken insgesamt weniger an durch Zecken übertragenen Krankheiten als Menschen und Hunde. Dennoch finden sich sowohl für Katzen als auch für Hunde eine Vielzahl weiterer möglicher Erkrankungen, die von einem Zeckenstich ausgehen können. Die Parasitolog*innen raten zu regelmässiger Untersuchung der Tiere auf Parasitenbefall beziehungsweise medikamentöser Prophylaxe.

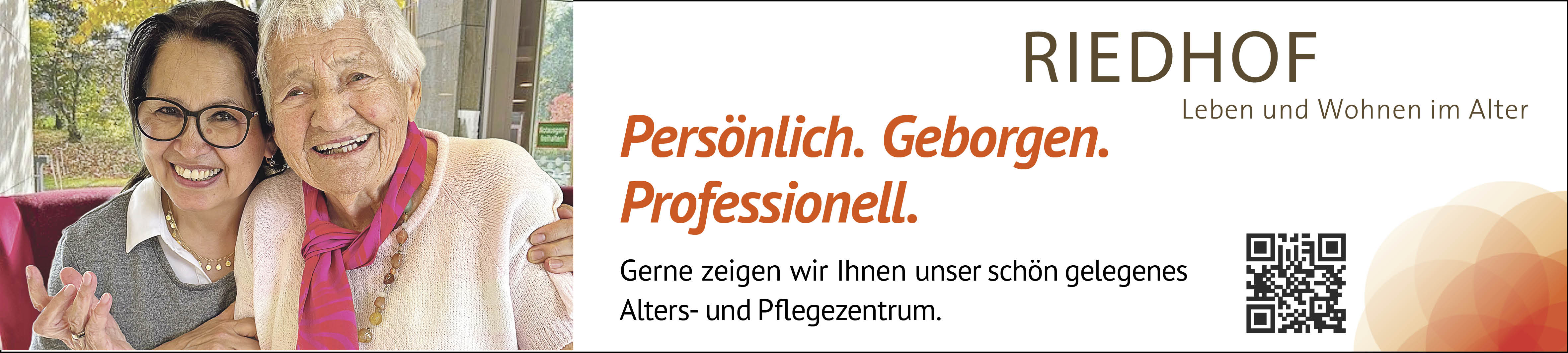
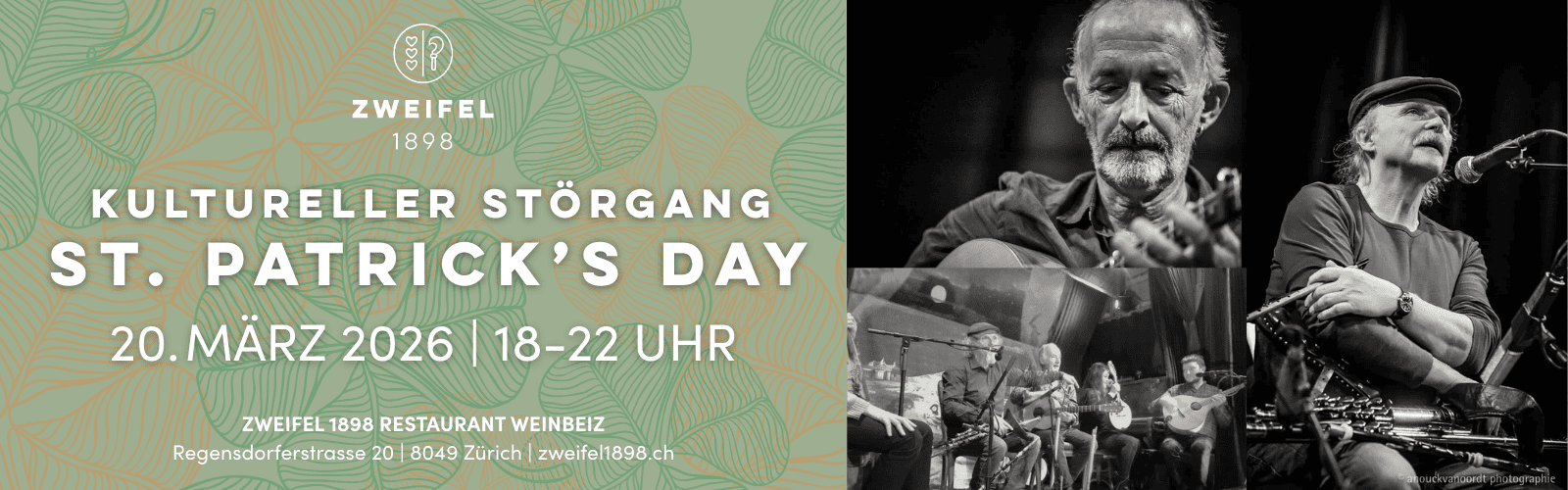


0 Kommentare