Kultur
Das Zukunftsministerium nimmt den Betrieb auf
Basierend auf dem Roman «Ministry for the Future» von Kim Stanley Robinson inszenierte das Theater Neumarkt mit der ETH Hönggerberg einen spannenden Theaterabend.
21. Februar 2025 — Dagmar Schräder
Schon die Informationen zum Theateranlass waren recht kryptisch gewesen: Treffpunkt bei der Bushaltestelle ETH Hönggerberg um 19 Uhr. Wen wird man dort treffen? Und was passiert dann? So recht wusste das Publikum nicht, was es zu erwarten hatte.
Dennoch war der Anlass mit 50 Teilnehmenden ausverkauft. Empfangen werden die Ankommenden von jungen Leuten in blauen Overalls, als Mitarbeitende des Ministeriums für die Zukunft erkennbar. Gesprochen wird Englisch, wie den ganzen Rest des Abends.
Wie das Publikum erfährt, hält das in Zürich ansässige «Ministry for the Future», das von den Vereinten Nationen ins Leben gerufen wurde, um im Kampf gegen die Klimakatastrophe auch den Interessen der kommenden Generationen ein Gewicht zu geben, ein Hearing ab.

Und die Gäste seien auserkoren worden, ihre Bürgerpflichten im Rahmen des «service citoyen:ne» wahrzunehmen. Alle erhalten einen Badge ausgehändigt, müssen sich via Smartphone und QR-Code registrieren und bekommen erste Informationen auf dem Handy zugespielt.
Dann kommt die Ministerin, gespielt von Sascha Ö. Soydan, persönlich vorbei. Allerdings hat sie nur wenig Zeit, um «Hallo» zu sagen, dann muss sie sich schon wieder entschuldigen und ein wichtiges Telefonat entgegennehmen, ganz Politikerin halt.
Am Ende der Odyssee
Als nächstes werden die Gäste mit einem Passanten konfrontiert, der aus dem Roman «Ministry for the Future» von Kim Stanley zitiert und düstere Zukunftsaussichten von sich gibt. Sehenden Auges, so die Aussage des Zitats, sei die Menschheit in die Katastrophe gerast. Doch bevor er richtig ausholen kann, geht es weiter ins «Arch tech lab»- Gebäude. Die Treppen hoch, durch die Materialausstellungen in den obersten Stock, wo ein blaues Uno-Zelt aufgebaut ist.
Auch dieser Checkpoint muss passiert werden, bevor sich die Teilnehmenden in einer Talkshow-Kulisse wiederfinden. Und hier ist auch die Ministerin, schon wieder nicht ganz bei der Sache, sondern noch ganz geschäftig dabei, Fernsehinterviews zu geben.
Das Publikum setzt sich, endlich hat die Ministerin Zeit und bedankt sich bei den unfreiwillig Freiwilligen für ihren Einsatz. Wir schreiben das Jahr 2034, so wird den Zuhörenden bewusst. Die «Terrible Twenties», wie sie an diesem Abend genannt werden, sind vorbei, in denen grosse Teile der Welt und der Entscheidungsträger die Klimakatastrophe noch leugnen konnten. Trump ist ebenso Geschichte wie Google, jetzt geht es darum, als Weltgemeinschaft Lösungen für die Probleme zu finden.
Fiktive Minsterin, echte Forschende
Nun wird aus der fiktiven Geschichte Realität – zumindest teilweise. Denn die Ministerin interviewt nun drei Wissenschaftler*innen, die sich mit den Herausforderungen des Geoengineerings auseinandersetzen. Sandro Vattioni, Claudia Mohr und Thomas Stocker stehen gemeinsam Rede und Antwort. Was sie berichten, klingt wie aus einem Science-Fiction-Roman, könnte aber tatsächlich Realität werden.
Vattioni hat sich mit dem solaren Geoengineering beschäftigt und in einer Studie untersucht, inwiefern Aerosole, die in die obere Atmosphärenschicht eingebracht werden, dafür sorgen könnten, dass ein Teil der Sonneneinstrahlung direkt zurück ins Weltall reflektiert wird. Dies könnte einen kühlenden Effekt auf das Klima haben.
Auch Claudia Mohr, Professorin für Aerosolchemie am Departement Umweltwissenschaften der ETH Zürich, setzt sich mit dem Klimawandel auseinander. Der dritte Experte ist ebenfalls sehr bewandert in Klimafragen: Thomas Stocker, Ehrendoktor der ETH Zürich, war während sieben Jahren Mitglied des Weltklimarates IPCC und ist einer der renommiertesten Klimaforscher weltweit.
Gemeinsam diskutieren sie über die Chancen der Technologie, aber auch über deren Nebenwirkungen und Risiken. Die Anwendung von Geoengineering könne lediglich die Symptome des Klimawandels bekämpfen, keinesfalls die Ursachen. Doch wenn die Ziele zur Abkehr von fossilen Energieträgern und zur Verringerung des CO2-Ausstosses weiterhin nicht annähernd erfüllt würden, könnte es vielleicht notwendig werden, das Fortschreiten der Erwärmung wenigstens ein wenig auszubremsen.
Gleichzeitig sei die Technologie momentan aber noch kaum ausgereift genug und liesse eine Unmenge an Fragen offen, ganz zu schweigen von den politischen Herausforderungen, die eine solche Massnahme, mit sich bringen würde. Denn um Aerosole in die Stratosphäre einzubringen und weltweit die Temperatur zu senken, müsste sich die gesamte Weltgemeinschaft zunächst einmal an einen Tisch setzen und im Konsens eine Antwort generieren.
Wahl zwischen Pest und Cholera
Zum Ende der Veranstaltung werden die Gäste schliesslich aufgefordert, als Mitglieder des «Service Cityoen:ne» ein Votum zum Einsatz von Geoengineering abzugeben. Eine Wahl zwischen Pest und Cholera. Eine Ratlosigkeit macht sich breit, die tatsächlich keine Fiktion ist, sondern auch in der aktuellen Politik und den tatsächlichen Entscheidungsträgern weit verbreitet ist.
Doch bange Untätigkeit, das wird an diesem Abend klar, gilt angesichts der drohenden Katastrophe nicht. Denn, so zitiert die Ministerin in ihren abschliessenden Worten die Schriftstellerin Rebecca Solnit: «Hoffnung ist kein Lottoschein, mit dem man auf dem Sofa sitzen und sich glücklich fühlen kann. Es ist eine Axt, mit der man im Notfall Türen einschlägt.»

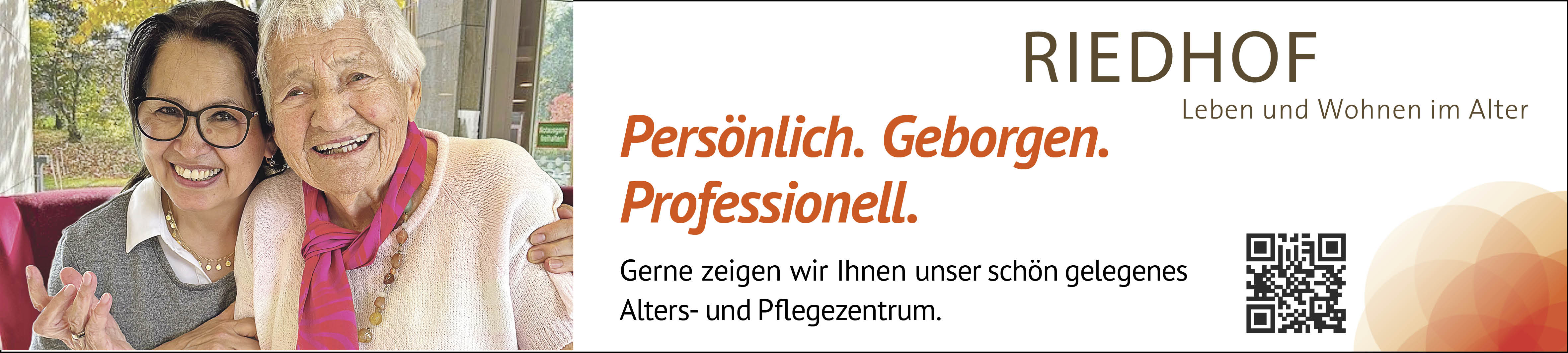


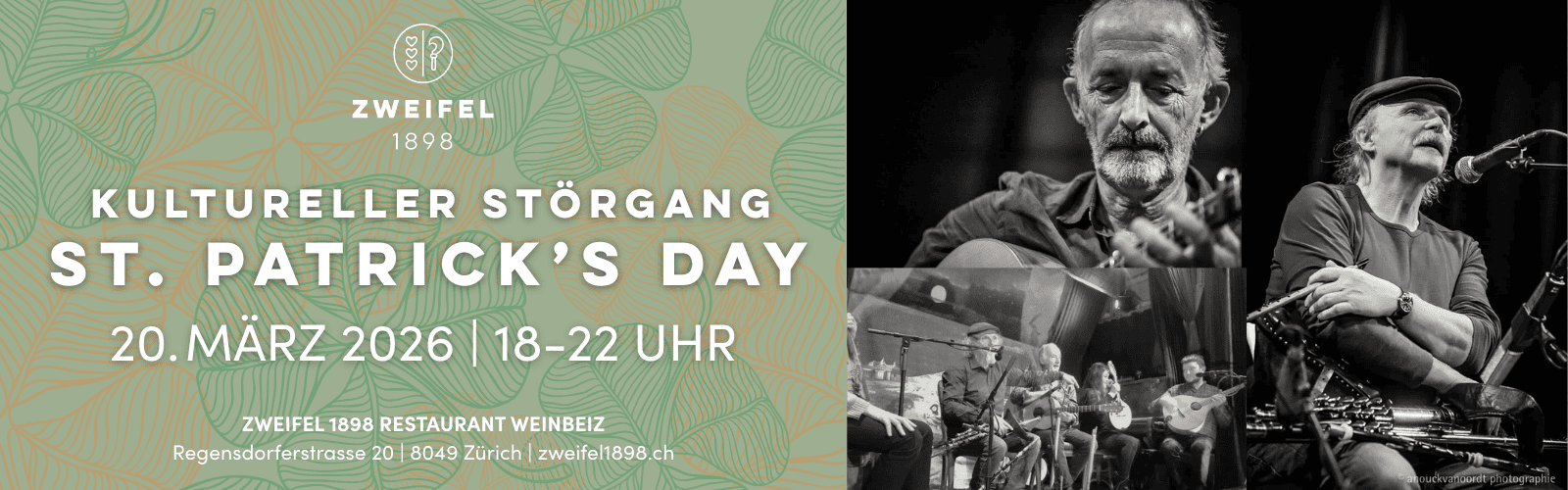
0 Kommentare