Quartierleben
«Das Höngger Publikum war fabelhaft»
Auf Einladung des Forums, der Kulturkommission des Quartiervereins, war Maria Becker im April für eine Lesung zu Gast in Höngg. Nun hat der «Höngger» die Schauspielerin in ihrem Heim in Zürich-Riesbach zu einem Gespräch getroffen.
3. Juni 2010 — Redaktion Höngger
Interview: Liliane Forster
«Höngger»: Im April haben Sie aus Ihrem Buch «Schliesslich ist man doch jeden Abend ein anderer Mensch» gelesen, das Sie sich und uns zum 90. Geburtstag Anfang dieses Jahres geschenkt haben. Das Höngger Publikum war begeistert von Ihrer Lesung. Wie haben Sie diesen Abend erlebt?
Maria Becker: Ganz toll. Ich habe das Publikum so fabelhaft gefunden, die Leute sind so mitgegangen. Wir waren uns erst nicht ganz sicher, ob’s nicht zu lang wird, und dann habe ich gemerkt: Die Leute hören so zu und sind so dabei. Das war ganz fantastisch, auch für mich. Es war die vierte Lesung aus meinem Buch, die ich gemacht habe.
Machte es für Sie einen Unterschied, dass mit der Lesung aus Ihrem Buch Ihr eigenes Leben im Mittelpunkt steht und nicht das Werk eines Dichters oder Autors, welches Sie interpretieren?
Ja, das ist ein Riesenunterschied. Es ist etwas vollkommen anderes, ob man seinen eigenen Text liest oder eine Dichtung oder was auch immer. Es ist ein anderer Vorgang.
Gehen wir zurück ins Jahr 1938: Nach Ihrer Emigration aus Berlin über Wien, wo Sie am Reinhardt-Seminar studierten, und London in die Schweiz, wurden Sie 1938 am Schauspielhaus Zürich engagiert. Wie war das damals?
Die Neue Schauspiel AG war eben gegründet worden, das Theater stand neu unter der Direktion von Oskar Wälterlin. Ich bekam ja eine lächerlich kleine Gage, ich hatte 180 Franken im Monat, die Saison dauerte zehn Monate. Während der restlichen Zeit musste man sehen, wie man sich Geld verschaffte. Mein Zimmer allein kostete 60 Franken.
Sie schreiben in Ihrem Buch von unglaublichen 28 Premieren pro Saison. Wie waren diese überhaupt zu bewerkstelligen?
Es waren nicht immer 28 Premieren, auch weniger. Wir hatten jeweils zehn Tage für die Proben bis zur Premiere. Die kurze Vorbereitungszeit ging aber nicht auf Kosten der Qualität. Wie an subventionierten Theatern üblich, spielten wir auch damals mehrere Stücke gleichzeitig, nicht nur eines. Manchmal gab es dann nur fünf oder sechs Aufführungen, es war wirklich eine Tretmühle.
Wie erarbeiteten Sie die oft komplexen Charaktere Ihrer bald tragenden Rollen? Sie waren damals kaum 20 Jahre alt.
Man lernt die Rollen auswendig, probiert und spielt. Ich hatte ja noch keine Theatererfahrung. Es waren im Grunde alles neue Rollen für mich.
Sie haben im Laufe Ihrer Karriere viele Rollen mehrmals gespielt, und jedes Mal erarbeiteten Sie sich die Figuren wieder neu.
Ja, ich habe sie immer wieder neu gelernt und angelegt. Lagen zwischen zwei Aufführungen mehrere Jahre, hatte ich mich verändert, und auch die Gesellschaft hatte eine Entwicklung durchgemacht. Das floss in die Interpretation einer Rolle mit ein.
In Ihrem Buch schreiben Sie, dass die Schauspielerin Paula Wessely ein grosses Vorbild für Sie war und im hohen Alter einmal zu Ihnen sagte: «Das Theater hat ganz strenge Gesetze.» Wie dürfen wir das verstehen?
Es geht darum, was es bedeutet, wenn man von links auf die Bühne kommt oder von rechts. Oder die Hand so oder anders hebt, um die Aussage zu unterstützen. Für mich geht es um Inhalte, um eine Botschaft, nicht um Verpackung oder darum, jeden Einfall, der einem durch den Kopf schiesst, auf die Bühne zu bringen. Aber weil man sich an keine Traditionen mehr halten wollte, wurde all dies entscheidend. Für mich ist es heute im Grunde genommen gar nicht mehr mein Beruf. Ich hätte gerne mehr Filme gemacht. Film ist etwas Fabelhaftes, das habe ich geliebt. Dass man Miniatur arbeiten kann mit der Kamera, man muss nicht einen Zuschauerraum füllen, sondern konzentriert sich auf jede einzelne Sequenz. Das Arbeiten in Stücken gefällt mir, auch das Warten zwischendurch macht mir nichts aus.
Ein Kapitel überschreiben Sie mit: «Liebe meines Lebens». Gemeint ist damit Robert «Bobby» Freitag, den Sie 1939 in Zürich kennenlernten und 1945 heirateten. Der erste Satz dieses Kapitels lautet: «Wenn Männer klug sind, humorvoll und gescheit, das mag ich.» Was machte die Liebesbeziehung zwischen Ihnen beiden für Sie so einzigartig?
Ja, das war die Liebe meines Lebens, da kann ich gar nichts dazu sagen. Er ist es noch.
Gibt es die «grosse Liebe» höchstens ein Mal im Leben?
Bei mir war es so. Man begegnet der Liebe, wenn man Glück hat. Ich habe nach meiner Scheidung schon auch mit anderen Männern gelebt, aber es war nicht mehr das Gleiche.
Ihre Ehe wurde 1964 geschieden. Sie beschreiben das im Kapitel «Man kann sich auch gut scheiden lassen»…
Ja, Bobby und ich sind sehr befreundet. Am Anfang habe ich mit der Situation gehadert. Letztendlich habe ich mich darauf eingestellt. Das war nicht leicht damals. Und auch mit Maria Sebaldt, Bobbys zweiter Ehefrau, bin ich befreundet.
«Drei Söhne – plötzlich waren sie da», ist eine weitere Kapitelüberschrift. 1946 kam Sohn Christoph zur Welt, 1948 Oliver Tobias und 1952 Benedict. Gab es auch ein «bürgerliches» Leben der Maria Becker als Mutter und Hausfrau?
Es gab immer ein bürgerliches Leben. Es ging eigentlich, nicht immer einfach, aber ich hatte Unterstützung durch ein Kindermädchen. Schwierig wurde es, wenn ich auf Tournee war. Das war für die Kinder sehr unangenehm, wenn weder Bobby noch ich zu Hause waren.
Was bedeutet Ihnen die Familie heute?
Sehr viel. Die ist mir sehr wichtig. Ich habe, Gott sei Dank, eine wunderbare Beziehung zu meinen Söhnen, mit ihnen bin ich sehr verbunden. Ich habe sehr viele Enkel und bereits Urenkel. Heute sehe ich auch, dass durch meine Scheidung nicht etwas weggefallen ist, sondern etwas zu meinem Leben dazugekommen ist. Ich arbeite auch sehr gerne mit meinem Sohn Benedict zusammen, es ist eine Erfüllung für mich, mit ihm Theater zu spielen.
Frau Becker, Sie sind im Januar 90 Jahre alt geworden. Ich frage nicht: Haben Sie noch Pläne, sondern: Welche Pläne haben Sie noch?
Geplant war eine Tournee der Schauspieltruppe Zürich im Herbst mit einem Stück, das ich inszenieren sollte, doch daraus ist wegen schlechten Verkaufszahlen nichts geworden. Lesungen habe ich immer wieder, die mache ich auch sehr gerne. Kürzlich las ich im Theater Rigiblick wieder «Die schwarze Spinne» von Gotthelf, zusammen mit einem fabelhaften japanischen Perkussionisten. Und ich liebe es, auf Tournee zu gehen.
Das letzte Kapitel Ihres Buches heisst «Mit 60 erst zu Verstand gekommen». Wie meinen Sie das?
Das meine ich so, wie ich es sage. Ich habe vieles nicht begriffen und nicht verarbeiten können. Ich bin heute toleranter, kann auch mal eine andere Meinung stehen lassen.
Was bereitet Ihnen heute, jetzt Freude?
Mein Leben. Ich finde es sehr interessant zu leben. Es sind andere Dinge als früher. Ich lebe gerne und ich bin neugierig, das spielt eine grosse Rolle. Mich interessiert ES.
Noch eine letzte Frage, Frau Becker: Waren Sie jeden Abend auf der Bühne ein anderer Mensch?
In der Rolle ja, wahrscheinlich, in gewissem Sinn. Durch die Rollen, die ich gespielt habe, musste ich ja ein anderer Mensch sein, denn ich spielte ja andere Menschen. Dass ich mich auf andere Rollen einlassen musste, hat mich auch immer aus einer mir eigenen Trägheit gerissen.
Frau Becker, ich danke Ihnen für das sehr offene Gespräch und wünsche Ihnen von Herzen gute Gesundheit, schöne Erfolge vor und auf der Bühne und viele bereichernde Augenblicke mit klugen, humorvollen und gescheiten Menschen, die Sie so lieben.
Buch: «Schliesslich ist man doch jeden Abend ein anderer Mensch», erschienen im Pendo Verlag. ISBN 978-3-86612-233-8.
Maria Becker verstarb am 5. September 2012 in Uster. Die Familie teilte mit, dass sie friedlich in ihrer Wohnung entschlafen sei.


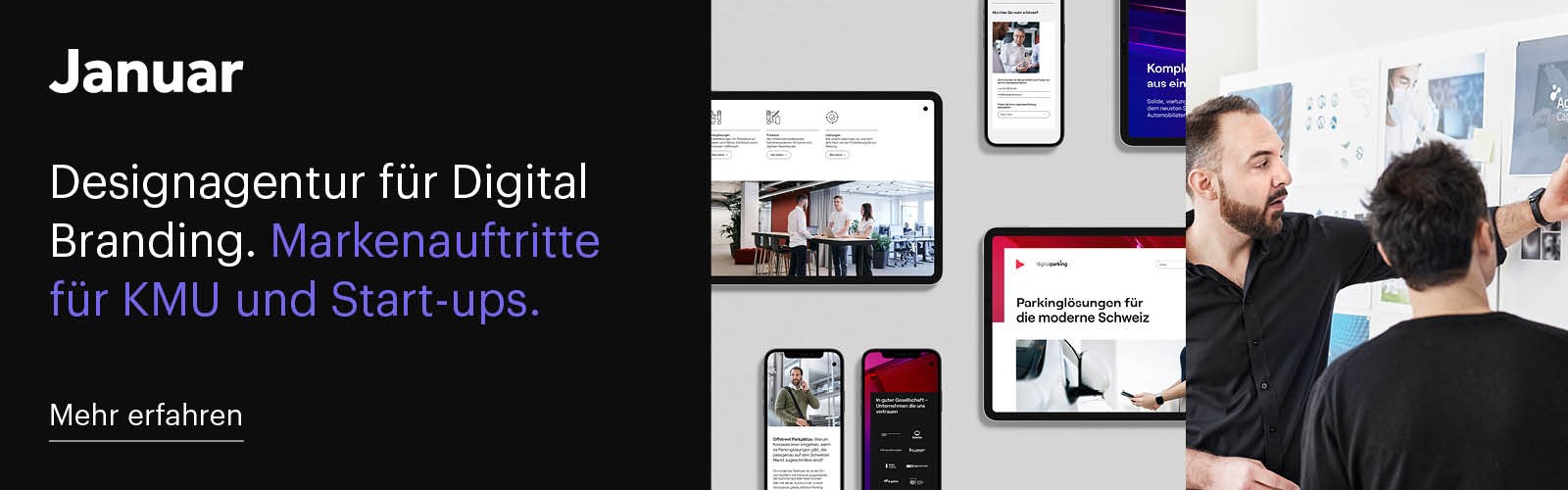

0 Kommentare