Quartierleben
«Wohnungssuche ist ein Fulltime-Job»
Anfang Februar wurde im Sonntagsklatsch im GZ Höngg über das hochaktuelle Thema «Wohnen» diskutiert. Gastreferentin war die Architektin Claudia Thiesen.
15. Februar 2025 — Dagmar Schräder
Wohnraum in der Stadt Zürich ist knapp, das ist mittlerweile hinlänglich bekannt. Mietwohnraum, der einigermassen bezahlbar ist, ist noch viel knapper. Diesem Problem versuchen die gemeinnützigen Wohnungsträger wie die Stadt und die Genossenschaften entgegenzuwirken – mit bisher mässigem Erfolg. Vom erklärten Ziel der Stadt, den gemeinnützigen Sektor auf einen Drittel der Wohnungen zu erhöhen, ist man noch weit entfernt – der Prozentsatz liegt seit Jahren bei etwas mehr als einem Viertel.
Woran liegt das und wie lässt sich der Trend zu immer teureren Wohnungen aufhalten? Wie lässt sich bezahlbarer Wohnraum für alle sicherstellen? Über diese Fragen diskutierte Moderator Andres Büchi Anfang Februar mit der Architektin Claudia Thiesen im Sonntagsklatsch. Eine Reihe, die von den beiden Hönggerinnen Verena Walther und Ljuba Malik im GZ Höngg organisiert wird. Thiesen ist nicht nur Mitinhaberin des Architekturbüros Thiesen und Wolf, sondern selbst auch in einer Genossenschaft in Höngg wohnhaft: Sie lebt im Heizenholz im Kraftwerk 1. Mit dem Thema «gemeinnütziger Wohnungsbau» ist sie daher bestens vertraut – und sie teilte ihre Erfahrungen mit dem Publikum.
Die Unterschiede bei den Mietkosten
In ihrem kurzen Inputreferat veranschaulichte sie zunächst, wie sich die Mietpreise in Zürich in den letzten Jahren entwickelt haben – und worin der Unterschied zwischen den Kostenmieten der gemeinnützigen Wohnungsträger und den Mieten auf dem freien Markt besteht. Sie erläuterte anhand statistischer Daten der Stadt, wie gross der Preisunterschied zwischen den Mieten im privaten und gemeinnützigen Bereich ist.
Die günstigeren Mieten im gemeinnützigen Wohnungsbau kommen unter anderem dadurch zustande, so Thiesen, dass in diesem kein Profit aus den Mieteinnahmen gezogen und das Land der Spekulation entzogen wird. Auf dem freien Markt dagegen regeln Angebot und Nachfrage den Preis. Zwar gebe es auch hier verfassungsmässig verankerte Aufträge an den Bund, den Wohnungsbau zu fördern und missbräuchliche Mieten zu verhindern. Aber die Frage sei, wie das zu kontrollieren ist.
Auch das Problem des begrenzten Bodens schnitt Thiesen in ihren Ausführungen an. Denn wo die Bodenpreise bereits wie in der Stadt Zürich hoch sind, sei es schwierig, günstigen Wohnraum anzubieten – das stelle auch Genossenschaften und gemeinnützige Wohnungsträger*innen vor grosse Herausforderungen.
Wohnen neu definieren?
Vielleicht, so warf Thiesen die Frage auf, müsse man einen Schritt weiterdenken und eine generelle Neudefinition des Begriffs «Wohnen» in Betracht ziehen. Im Kraftwerk 1 würden etwa, so Thiesen, bereits verschiedene neuere Wohnformen praktiziert – zum Beispiel in den Clusterwohnungen, die Platz für bis zu 10 Personen bieten. Diesen steht jeweils eine abgeschlossene kleine Wohneinheit mit eigenen sanitären Einrichtungen sowie einer kleinen Teeküche zur Verfügung, Wohnzimmer und Küche werden aber mit allen anderen Bewohnenden geteilt. Anders als in konventionellen WGs haben so die einzelnen Personen die Möglichkeit, sich zurückzuziehen und gleichzeitig gemeinschaftliche Räume zu nutzen. Das spart nicht nur Platz und Baukosten, sondern sorgt auch für engere soziale Beziehungen.
Viele Fragen – wer kennt die Antworten?
Doch auch generellere Fragen wurden an diesem Vormittag angeschnitten – wie etwa diejenige nach den Kosten für Land und Boden: Wem gehört eigentlich das Land und zu welchem Preis darf es verkauft werden? Und inwiefern macht es überhaupt Sinn, Immobilien und Grundstücke als Spekulations- und Renditeobjekte zu verwenden – etwa, indem Pensionskassen im grossen Stil in Immobilien investieren?
Grosse Fragen, auf die keine leichten Antworten zu finden sind. Das wurde auch in der angeregten Diskussion mit dem anwesenden Publikum klar. Spürbar war hier eine gewisse Ratlosigkeit – und Frust. Einerseits bei denjenigen, die schon länger auf der Suche nach einer bezahlbaren Wohnung sind oder bereits eine lange Suche hinter sich haben: «Wohnungssuche ist ein Fulltime-Job, das ist klar», so eine der Anwesenden. Andererseits auch bei denjenigen, die nicht das Glück oder Privileg haben, eine genossenschaftliche Wohnung zu haben.
«Denn», so gab eine weitere Zuhörerin zu bedenken, «bei den über 70 Prozent der Mietenden, die nicht das Glück haben, in einem gemeinnützigen Wohnungsbau zu leben, macht sich ein gewisser Unmut breit.» Auch hier müsse politisch etwas unternommen werden, so die Forderung der Teilnehmenden. Die Aufträge an die Politik, das wurde an diesem Vormittag deutlich, sind klar. Die Lösungen allerdings weit weniger.

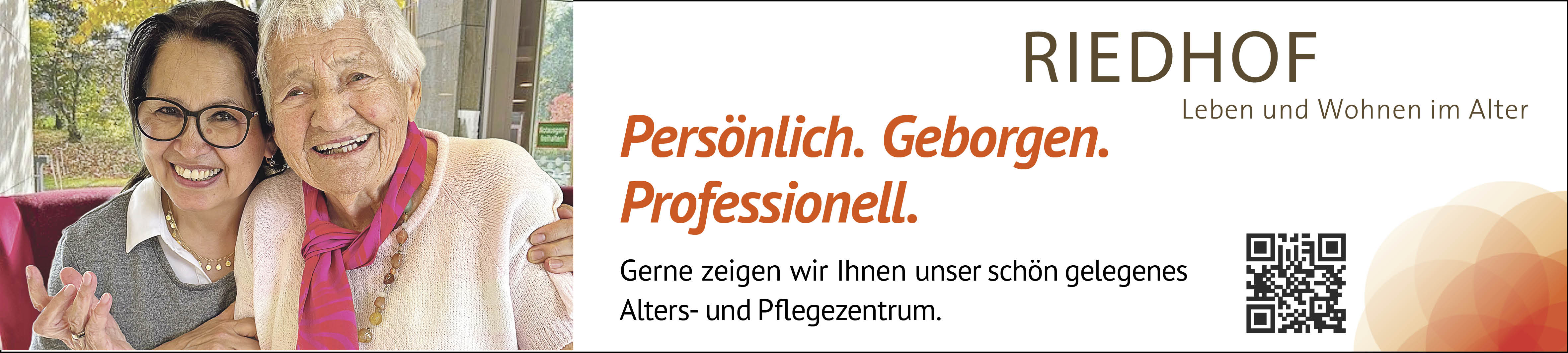


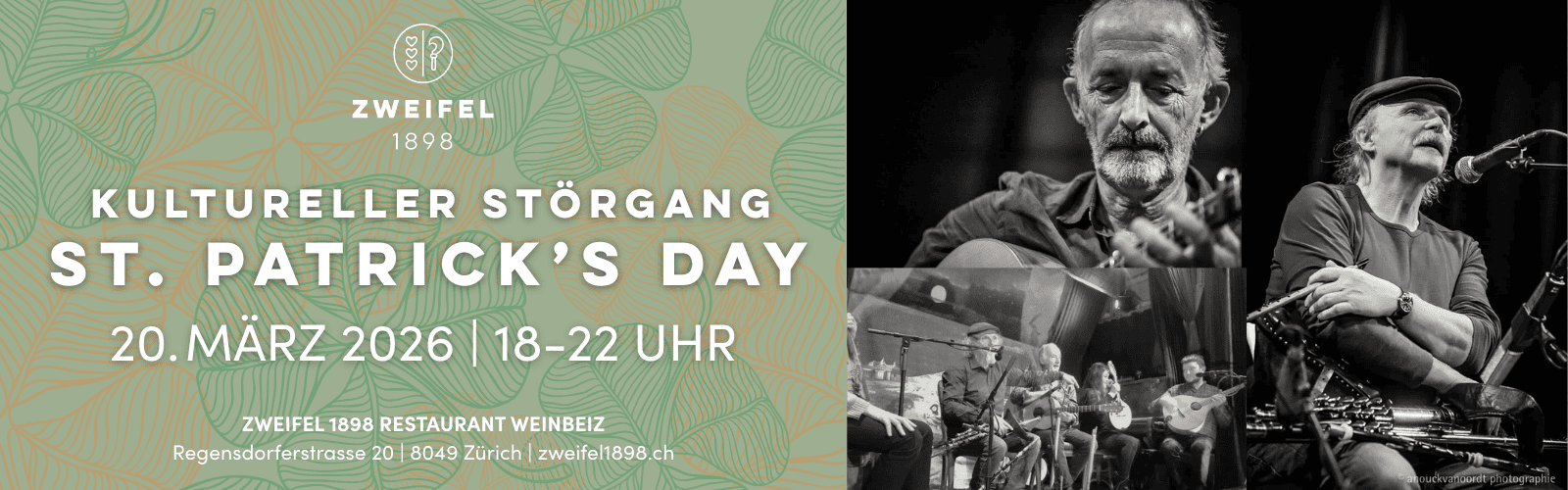
0 Kommentare