Alter
Wer pflegt uns im Alter?
An Krankenhäusern und Pflegeinstitutionen herrscht akuter Personalmangel. Die Gründe sind vielschichtig, die Sachlage komplex, einfache Lösungen gibt es nicht.
31. Juli 2025 — Dagmar Schräder
Das Problem ist bekannt: In Schweizer Krankenhäusern und Pflegeinstitutionen ist das Personal Mangelware. Und die Situation wird sich weiter verschärfen: Gemäss den Zahlen des Schweizerischen Gesundheitsobservatoriums könnten es bis zu 20 000 Pflegende sein, die bis zum Jahr 2029 schweizweit fehlen. Die Gründe dafür sind vielfältig. So sorgt die demografische Entwicklung für einen steigenden Bedarf an qualifiziertem Personal.
Gleichzeitig ist der Alltag der Pflegenden von hoher Belastung geprägt. Die Arbeitszeiten, schlechte Entlöhnung und nur bedingt mögliche Kombination von Familie und Beruf machen den Job auf Dauer unattraktiv, die Fluktuation ist hoch. Mit der Pflegeinitiative, die Ende 2021 angenommen wurde, wird auf Bundesebene versucht, die Pflegeausbildung zu stärken und die Arbeitsbedingungen zu verbessern.
Auch in der Stadt Zürich wird das Problem in Angriff genommen. Wie dies konkret geschieht, das erläuterte Stadtrat Andreas Hauri gemeinsam mit Vertreter*innen des Stadtspitals Zürich und der Gesundheitszentren der Stadt Zürich an einer Medienkonferenz im Juni. Sie informierten über das Programm «Stärkung Pflege», das im Jahr 2022 gestartet wurde.
Das Massnahmenpaket
Das Programm beinhaltet ein Massnahmenpaket, das aus den vier Punkten Flexibilität, Entlastung, Empowerment sowie Aus-, Weiter- und Fortbildung besteht. Der Punkt Flexibilität bezieht sich auf den Berufsalltag und soll die Vereinbarkeit von Familie und Beruf erleichtern.
So sollen Einsatzpläne durch die Pflegenden in Zukunft mitgestaltet werden können. Der Arbeitsbeginn soll flexibel gestaltet werden können, geteilte Dienste werden flächendeckend abgeschafft. Jobsharing wird vermehrt auf allen Ebenen ermöglicht, Löhne werden angepasst und die Ferien erweitert.
Verwandter Artikel
Entlastung und Empowerment sollen erstens in Form von fachlicher Unterstützung gewährleistet werden, aber auch in der Schaffung von neuen Berufsbildern und Ausbildungswegen. Dazu gehört etwa der Fachbeauftragte Geriatrie oder der CAS Intercare, die sich auf die Pflege älterer Menschen konzentrieren, aber auch der Ausbildungsweg Advanced Practice Nurses, der die Kompetenzen der Pflegenden gegenüber Ärzten stärkt. Generell soll bei den Beschäftigten das Potenzial besser erkannt werden, ein Talentpool die Förderung besonderer Talente ermöglichen.
Das Zwischenfazit, das die Stadt nun zieht, ist positiv. In den vergangenen drei Jahren seien die Löhne erhöht und die Ausbildungsplätze erhöht worden. Rückläufig sei dagegen die Fluktuation in den Gesundheitsinstitutionen, die sich seit 2022 deutlich gesenkt habe. Und während die Massnahmen wie Lohnerhöhung und Ausbildungsförderung natürlich Kosten verursachten, habe der Abbau von Temporärstellen zu Einsparungen von rund 11,5 Millionen Franken geführt.
Ein internationales Problem
Doch das Problem ist bei Weitem nicht nur lokaler oder nationaler Natur. Das machte die Podiumsdiskussion «Wer pflegt uns morgen?» der Nichtregierungsorganisation Solidarmed Ende Mai deutlich. Denn der Mangel an verfügbaren Fachkräften im Inland hat einen Dominoeffekt zur Folge: Weil der Bedarf an Pflegenden hierzulande nicht gedeckt werden kann, rekrutiert die Schweiz Personal im Ausland – rund 30 Prozent der Beschäftigten haben, so Zahlen aus dem Jahr 2021, ihre Ausbildung im Ausland absolviert. Sie stammen fast alle aus den europäischen Nachbarländern.
Und um deren eigene Personallücken zu decken, rekrutieren diese Länder selber im Ausland – etwa im europäischen Osten oder den Ländern des Südens.
Mit gravierenden Konsequenzen: Sei die Migration für das einzelne Individuum verständlich und legitim, so Roswitha Koch vom Berufsverband der Pflegefachfrauen und -männer, stelle sie für die Gesundheitssysteme der Herkunftsländer eine wahre Katastrophe dar. Die Zahlen der WHO untermauern dies: So stehen in 83 Ländern in Afrika, Asien und Lateinamerika nur rund 22,8 Gesundheitsfachkräfte pro 100 000 Menschen zur Verfügung. Nicht einmal die elementarste Gesundheitsversorgung kann so gewährleistet werden.
Hilft ein internationaler Kodex?
Initiativen wie Solidarmed unterstützen die Länder des Südens darin, die Ausbildungs- und Arbeitsbedingungen im eigenen Land zu verbessern, um den Verbleib von Fachpersonal zu fördern. Doch es braucht auch Bemühungen innerhalb der Industrienationen.
Auf internationaler Ebene existiert daher seit 2010 der Verhaltenskodex «zur internationalen Rekrutierung von Gesundheitspersonal» der WHO. Er hält die Mitgliedsstaaten an, dem Mangel an Gesundheitsfachkräften abzuhelfen und aus eigener Kraft die Versorgung mit Fachkräften sicherzustellen. Allerdings sind die Vorgaben wenig bindend und werden nicht konsequent umgesetzt.
Im Gegenteil: Die Rekrutierung im Ausland hat seither auch hierzulande weiter zugenommen.
Lösungen sind hier schwer zu finden. Die Pflegeinitiative sowie die städtischen Programme könnten kleine Schritte in die richtige Richtung bedeuten. Doch es bedarf mit Sicherheit noch grosser Anstrengungen, um die Situation lokal, national und international zu entschärfen.
Im Fokus: Wertvolle Jahre
Der «Höngger» veröffentlicht auch in diesem Jahr verschiedene Artikel, die sich der Lebensrealität von Betagten und Menschen mit Behinderung widmen. Diese Reihe entsteht mit freundlicher Unterstützung der Luise Beerli Stiftung, die sich für solche Menschen stark macht.


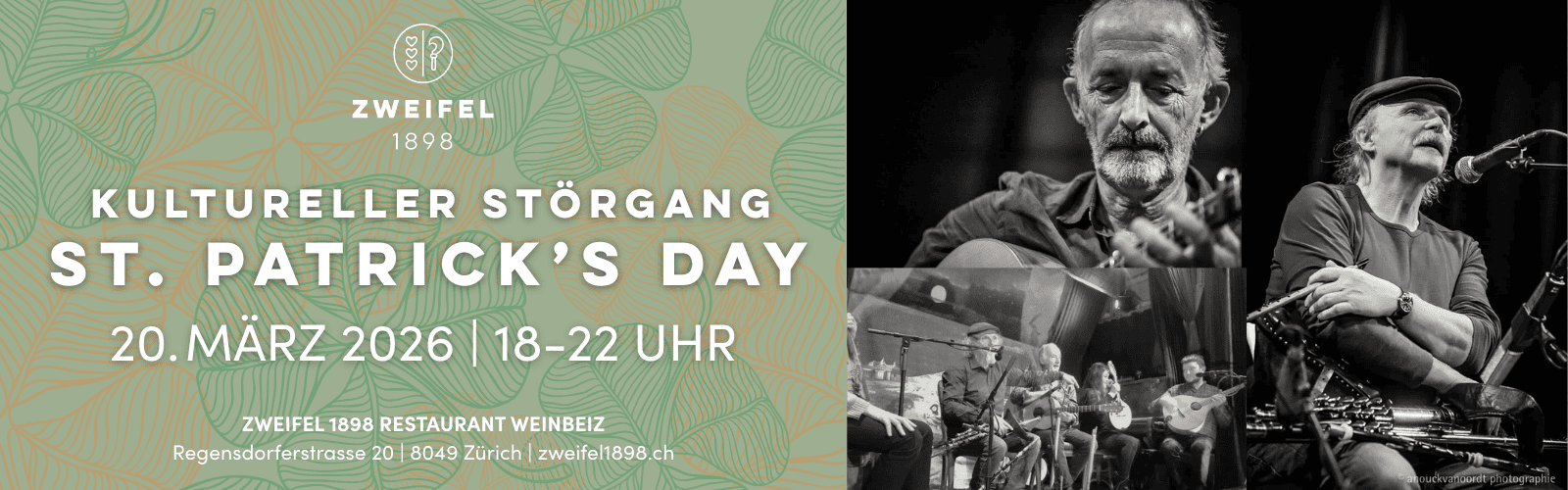

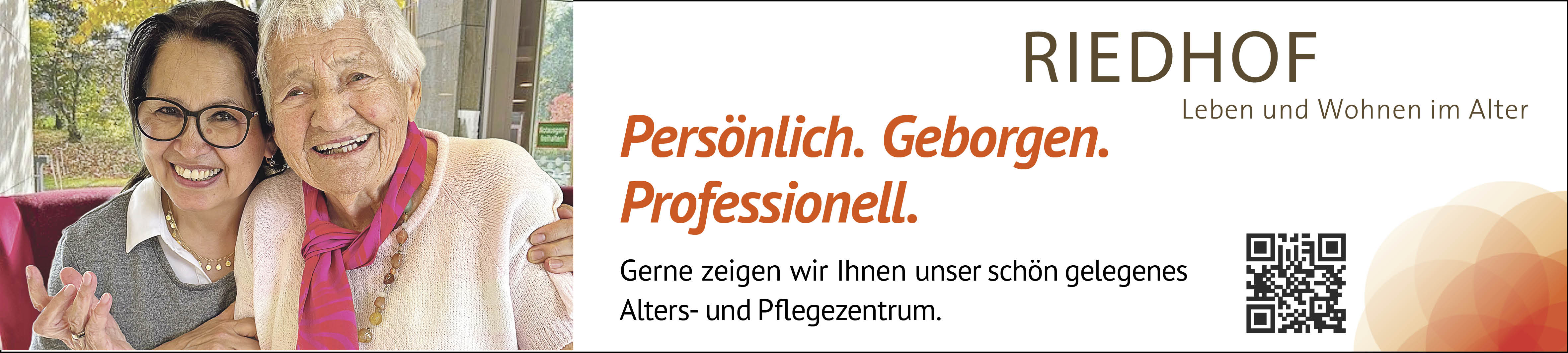
0 Kommentare