Stadt
Was liegt verborgen im Rütihof-Grossried?
Seit November letzten Jahres wird im Rütihof gegraben: Die Archäologinnen und Archäologen des Amts für Städtebau vermuten, auf die Überreste von rund 3000 Jahre alten Grabhügeln oder römische Funde zu stossen. Der «Höngger» erhielt einen aktuellen Einblick in die Arbeiten.
13. Januar 2016 — Fredy Haffner
Nass und schwer ist er, der Boden, an diesem Morgen auf dem Grabungsfeld Grossried, wie die letzte grosse, freie Bauparzelle im Rütihof heisst. Aber es regnet nicht, und für kurze Zeit drückt sogar die Sonne durch die bleiernen Wolken. Seit letztem November wird hier, wo eine Wohnüberbauung projektiert ist, nach Spuren vergangener Zeiten gegraben. «Dass wir hier graben, hat aber nichts mit dem Projekt zu tun», hält Andreas Mäder, Leiter der Unterwasserarchäologie und Dendrochronologie beim Amt für Städtebau, gleich zu Beginn der Begehung fest. Vielmehr sei es so, dass man jedes Bauland rechtzeitig abklären müsse, um bei einer Bebauung nicht vielleicht etwas für immer zu verlieren.
So ist die ganze Stadt in verschiedene archäologische Zonen aufgeteilt, in denen man Funde vermutet oder sogar mit Gewissheit erwarten kann. Auf das Gelände im Rütihof wurde man aufgrund von Funden im letzten Jahrhundert aufmerksam, zum Beispiel den nahen keltischen Grabhügeln im Heizenholz oder von einzelnen Steinbeilfunden und römischen Münzen. Doch dass man nun genau auf dieser Wiese sucht und nicht auf der anderen Strassenseite, das hat schon mit dem möglichen Bau zu tun: «Wir wollen einfach rechtzeitig abklären, um nicht zuletzt als Bauverhinderer dazustehen», hält Projektleiter Christian Bader fest.
So wurden 2014 Radaruntersuchungen gemacht, die Anomalien nicht natürlichen Ursprungs im Untergrund aufzeigten. In einem zweiten Schritt zog man Sondierschlitze im Gelände, welche die ersten Hinweise bestätigten, zumindest im nördlichen Teil, auf rund der Hälfte des Geländes. In der Baubaracke zeigt Bader auf der Karte eingezeichnete Funde und Befunde: «Funde» bezeichnen einzelne Gegenstände wie zum Beispiel Keramik oder Metall, «Befunde» hingegen Steinansammlungen wie Mauerreste oder auch Bodenverfärbungen, wie sie dort entstehen, wo einst ein Pfahl im Boden stand.
«Jedes Fundstück ist ein Schatz»
15 Personen, Archäologen und Studierende, sind am Werk. Alles spezialisierte Ausgräber, versiert, Funde im Gelände zu erkennen, zu bergen und fotografisch, zeichnerisch oder am Computer zu dokumentieren. Erwartet werden Gegenstände aus der Hallstattzeit, also jener Epoche, als die Kelten hier siedelten. «Unser Grundauftrag ist es, menschliche Hinterlassenschaften zu dokumentieren und zu bergen», erklärt Mäder. Fachleute wie er unterscheiden dabei nicht zwischen ganz alten Fundstücken oder solchen aus der nahen Vergangenheit und grenzen ihre Zunft damit klar vom Goldgräberimage ab: Aus archäologischer Sicht und im Kontext mit anderen Funden betrachtet, ist jedes Fundstück ein Schatz.
So liegen auf dem Tisch verschiedene «Schätze»: Ein Fünfrappenstück von 1915 und etwas, das aussieht wie der Rest einer Tabakpfeife – oder ist es vielleicht doch nur das Bruchstück eines Isolators, der einst einen Telefonmasten krönte? Klar erkennbar sind die beiden Musketenkugeln – ob sie wohl im Krieg abgefeuert worden waren, der 1799 hier zwischen Russen und Franzosen tobte? Und zwischen fast zur Unkenntlichkeit Verrostetem liegt, bereits sauber in der Plastikhülle, tatsächlich ein Teil einer römischen Schmuckfibel, wahrscheinlich aus dem späten ersten Jahrhundert.
Forschen ohne Emotionen
Der Laie stellt sich gleich vor, wie der Mensch, der damals das Teil verlor, sich ärgerte und fluchte, weil nun nichts mehr seine Toga zusammenhielt. Und er fragt, was das für die Archäologen für ein Gefühl sei, nach 2000 Jahren als Erste diese Fibel wieder in den Fingern zu halten? «Nichts Spezielles», so die einhellige Antwort. Nein, man beteilige sich als Forscher emotional nicht an der Geschichte eines einzelnen Fundes. Aufregender sei es, daraus neue Zusammenhänge abzuleiten: Erst im Verbund mit anderen Funden und Erkenntnissen entsteht letztlich «die» Geschichte – und die fasziniert, auch emotional, alle Menschen.
Doch bedauern Forscher nicht, dass Zeugnisse der Vergangenheit einfach überbaut werden? Mäder, dessen Fachstelle bei den spektakulären Rettungsgrabungen beim Bau des Opernhausparkhauses federführend war, erklärt, dass der gesetzliche Auftrag ihrer Arbeit primär dem Bodendenkmalschutz gelte: «Wenn ich diesen Hut anhabe, dann finde ich, man sollte die Zeugnisse im Untergrund belassen. Gerade Holzfunde aus der Pfahlbauerzeit lassen sich nirgends besser konservieren als im Boden. Aber wenn, wie beim Parkhaus Opéra, öffentliches Interessen überwiegt, dann machen wir eben eine Rettungsgrabung. Und dann schlägt dafür das Forscherherz höher, weil man etwas ausgraben kann und neue Erkenntnisse gewinnt.»
Vom Grossen bis ins Detail
Das Ausgrabungsgelände im Rütihof erweist sich als Berge und Flächen nasser Erde. Man wundert sich, wie darin ein Fundstück, klein wie ein Fingernagel, überhaupt erkennbar sein soll. Christian Bader lacht: «Wir geben uns Mühe, 100 Prozent zu entdecken, bilden uns aber nicht ein, dass dies auch der Fall ist.» Behilflich sind das geschulte Auge und die Routine. Oder man sucht mit dem Metalldetektor. Mit einem solchen schreitet gerade ein freiwilliger Mitarbeiter über das Gelände und stellt so sein über Jahre geschultes Ohr in den Dienst der Fachleute.
Generell werden die Werkzeuge der Situation angepasst: Nach den ersten, nichtinvasiven Abklärungen durch den Bodenradar oder Fotodrohnen, die aus der Höhe Auffälligkeiten erspähen, kommt der Bagger zum Einsatz und trägt, stets von fachmännischen Augen beobachtet, die erste Humusschicht ab. Dann geht es dort, wo Spuren wie Steinansammlungen oder Bodenverfärbungen auftauchen, mit der Schaufel weiter, die im Verlauf der Ausgrabung bis hinunter zur Grösse eines Spachtels mutiert. Gesucht wird bis auf den natürlichen Untergrund, hier Moränenmaterial, fast einen Meter tief.
Jeder Schritt wird fotografisch dokumentiert, Schicht für Schicht, und einzelne Fundstücke nummeriert und der Fundort aufgezeichnet. Doch Fotografien alleine bilden Bodenstrukturen nur ungenügend ab, deshalb werden diese später zeichnerisch hervorgehoben. Erst so zeichnet sich aus einer Verfärbung im Lehmboden plötzlich ein Pfahlloch ab und aus diesem, falls noch weitere gefunden werden, ein Haus, eine Palisade oder was auch immer – oder es zeigt sich, dass es ganz einfach die Reste eines Baumstrunks waren und nicht weiter von Bedeutung.
Graben mit System, auch am «Hotspot»
Gegraben wird nach einem Schachbrettmuster, quasi zuerst in den weissen Feldern, dann in den schwarzen. Dass das Sinn macht, zeigt sich gleich vor Ort: Hier wurden Spuren eines «Kanals» entdeckt. Jedenfalls werden sie im Moment noch als solcher benannt, die Bodenverfärbungen, die sich in einem Bogen über das erste Planquadrat ziehen. Findet man im diagonal dazu liegenden, «weissen» Grabungsfeld die selbe Struktur, weiss man schon vor dem ersten Spatenstich, dass man im angrenzenden «schwarzen» Feld ebenfalls etwas finden wird.
Unterdessen ist man beim grossen Zelt in der unteren Ecke des Geländes angelangt. Hier ist aktuell der «Hotspot», ein Feld aus grösseren Steinen in einer Anordnung, wie sie nicht natürlichen Ursprungs sein kann. Angrenzend daran muss einst ein Graben gewesen sein, erkennbar an der anderen Bodenstruktur. Darin stiess man auf Reste von Holzkohle. Wozu Steinfeld und Graben dienten, lässt sich jetzt noch nicht sagen. Erst Fundstücke würden Hinweise liefern, ob dieser Ort vielleicht der Schutzgraben einer Siedlung war oder gar eine Kultstätte.
Auch hier geht man methodisch vor: Ein Profilgraben wurde ausgehoben, in dem man Tiefe und Form des rätselhaften Grabens erkennt. Dessen Verlauf folgend werden schon bald weitere solche Profilgräben gezogen. Zuerst in grösseren Abständen und dann, je nach Anzahl und Bedeutung der Funde, weiter, bis vielleicht der ganze Graben freigelegt ist.
Von der Hallstattzeit ins Heute
Mehrere Dutzend solcher archäologischer Grabungen finden jedes Jahr auf Kantonsgebiet statt. Die Dokumentationen dazu füllen Lager und Archive, in denen später Forscher Schwerpunkte setzen und interdisziplinär versuchen, das örtliche Geschichtsbild zu rekonstruieren und etwas über den Besiedlungsverlauf, Handelswege und Kulturgeschichte einer Zeit abzuleiten.
Im Grossried steht alles noch fast am Anfang. Und man ist froh, dass bislang kein Schnee die Arbeiten verzögert. Ende Mai will man fertig sein. Zurück bleibt eine einfache Wiese – bloss weiss man dann, was darunter einst lag.
Jetzt aber geht es durch den Morast zurück zur Baubaracke. Nur noch mit einer kleine Ausgrabungskelle den Dreck von den Schuhen gekratzt – nein, eine Münze fiel nicht aus den Profilen – und zurück geht es aus der Hallstattzeit ins Heute. Die folgende Nacht giesst es wie aus Eimern – den Forschern steht ein weiterer Tag im schweren Boden bevor.
Archäologische Funde, die auf zürcherischem Gebiet gefunden werden, gehören dem Kanton Zürich (ZGB Art. 724). Die Fundobjekte (einzelne Gegenstände wie Tongefässe) werden zusammen mit sämtlichen Befunden (zum Beispiel Mauerreste) wissenschaftlich untersucht. Eine Auswahl der Objekte wird konserviert und restauriert. Anschliessend werden sie in den Funddepots der Kantonsarchäologie unter klimatisch günstigen Bedingungen aufbewahrt.


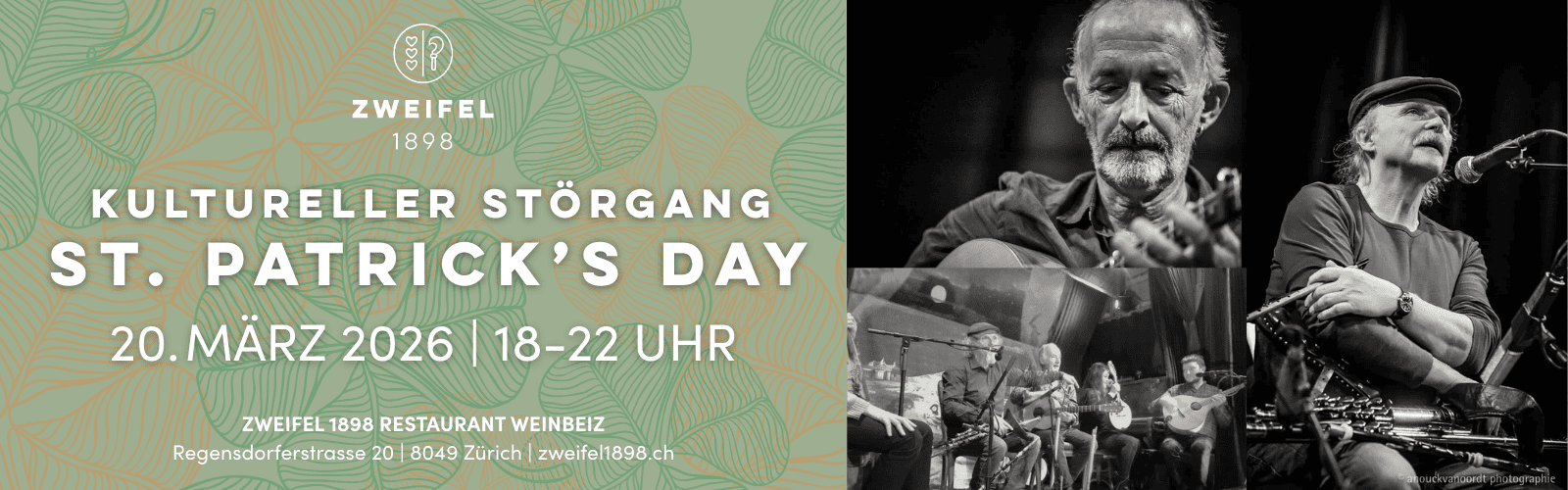


0 Kommentare