Höngger Wald
Privatwald, ein Generationenprojekt
Früher gehörte Wald zu jedem Bauernbetrieb. Auch in Höngg, gehegt und gepflegt über Generationen. Er war Lieferant von Holz und Kapitalanlage in einem. Heutigen Besitzern zählt die Liebe zum Wald und der Generationengedanke mehr, denn ein Geschäft ist privater Waldbesitz längst nicht mehr.
21. November 2018 — Fredy Haffner
220,6 Hektaren Wald verteilen sich auf Höngger «Gemeindegebiet» auf dem Höngger- und dem Käferberg. Davon gehören auf dem Hönggerberg 23,7 ha und auf dem Käferberg 17,2 ha privaten Eigentümern oder Kooperationen. Der «Höngger» begab sich mit Schaggi Heusser IV., Höngger Landwirt und einer der grössten Privatwaldbesitzer des Quartiers, auf einen Rundgang durch den Käferberg-Wald. Mit dabei Hans Nikles, pensionierter Revierförster und bis vor einem Jahr vom Privatwaldverein Höngg/Affoltern als Förster angestellt. Heute hat Förster Emil Rhyner dieses Amt inne.
Ausgangspunkt des Rundgangs ist eine Stelle, die für eine Durchforstung vorbereitet wurde, wie sie alle rund acht Jahre stattfindet. Entlang des Weges und im Wald sind Bäume zur Fällung markiert. Die Parzellen der Privaten sind zum Teil sehr klein. Nur wer den Wald kennt, findet die Grenzmarkierungen. Doch manchmal müssen auch Heusser und Nikles genau hinschauen, damit das geschlagene Holz später auch dem richtigen Besitzer zugerechnet wird. Das kann, wenn auch selten, kompliziert sein: «Ich mag mich nur an einmal erinnern, da stand ein mächtiger Baum tatsächlich genau auf einer Grenze und musste unter den beiden Besitzern aufgeteilt werden», bei Neubepflanzungen werde deshalb ein Grenzabstand von einem Meter eingehalten, erzählt Nikles, der Schaggi Heusser IV. auch heute noch gerne zur Hand geht.
Wald gehörte zum Hof
Zusammen betreuen sie die meisten der rund 48 Privatwaldbesitzer, die im Privatwaldverein Höngg/Affoltern zusammengeschlossen sind. Viele der Besitzer entstammen den alten Höngger Bauerngeschlechtern. «Früher hat Wald einfach zu einem Hof dazugehört», erzählt Nikles: «Im Winter, wenn die Arbeit der Bauern eher ruhte, begann die Arbeit im Wald, um Bau- und Brennholz zu gewinnen». Heute indes sind nur noch ganz wenige aktive Landwirte unter den Besitzern, die meisten anderen wollen oder können ihren Wald gar nicht mehr selber bewirtschaften. Aktiv betreut Heusser mit Unterstützung von Forstwart Felix Rutz und anderen Helfern viele Waldbesitzer, die ihren Wald nicht selber bewirtschaften können. Nur grössere Arbeiten werden an externe Unternehmen vergeben. Nikles: «Der Private ist sehr nahe beim Wald, es ist sein Wald – beim Staat oder in Kooperationen ist diese Nähe naturgemäss weniger vorhanden». Dieses Jahr ist es vor allem Käferholz, das geschlagen werden muss, denn der trockene Sommer hat dem Wald drei Generationen Borkenkäfer beschert. Die Schäden sind unübersehbar und das Holz muss so schnell wie möglich aus dem Wald, um eine weitere Ausbreitung des Schädlings zumindest einzuschränken.
Kaum kostendeckende Erträge
Das Holz, das nach dem Käferbefall von einem bläulichen Pilz befallen wird, dient noch als Bau-, manchmal auch nur noch als Brennholz. Bescheidene 50 Franken löst man aktuell für den Kubikmeter transportbereites Käferholz bei Sägereien oder Holzhändlern, mit denen man seit Jahren kooperiert. In den 1980er-Jahren waren die Preise fast doppelt so hoch.
Der Ertrag geht an die Besitzer, doch seit einigen Jahren ist die Bewirtschaftung des Waldes kaum noch kostendeckend. Nur durch Rationalisierung und den Einsatz von Vollerntern – Maschinen, die einen Baum festhalten, umsägen, entasten und gleich in Stücke sägen – liesse sich noch etwas herausholen, doch dafür sind die in den Privatwäldern zu schlagenden Mengen oft zu klein. Die Öffentlichkeit begegnet den Vollerntern mit Skepsis, doch die Fachleute verteidigen sie: «Man muss ihnen zwar etwas breitere Wege in den Wald freihalten als für Arbeiten mit dem Traktor, sogenannte Rückegassen, doch die sind innert wenigen Jahren durch den Jungwuchs kaum mehr zu erkennen», so Heusser, und Nikles fügt an, dass Vollernter insgesamt beim Holzschlag schonender seien, da die von ihnen gefällten Bäume im umliegenden Wald gezielter fallen.
Wer sich achtet, entdeckt im Wald tatsächlich rund alle 30 Meter solche Rückegassen in unterschiedlichen Bewachsungsstadien. Nur auf ihnen darf überhaupt mit Maschinen aller Art in den Wald gefahren werden, auch die privaten Waldbesitzer sind diesem Standard verpflichtet.
Doch zurück zu dem für eine Durchforstung vorbereiteten Waldteil. Nikles’ geübtes Auge entdeckt schnell noch einige weitere Rottannen, die vom Borkenkäfer befallen sind und noch nicht markiert wurden. Heusser merkt sie sich für die Arbeiten am folgenden Samstag vor. Dann werden auch andere schlecht gewachsene oder kranke Bäume gefällt. So wird der Wald aufgelichtet, die guten Bäume und der Jungwuchs erhalten mehr Licht – und so entsteht auch ein Dauerwald mit einer erkennbaren Stufung, vom Jungwuchs in den unteren und mittleren Schichten bis zu den hohen Bäumen, in deren Schatten zum Beispiel Weisstannen und Buchen von selbst gut wachsen. Der Blick auf den Boden zeigt, dass die kleinen Tannen keimen wie wild – vorausgesetzt, der Boden ist nicht von Brombeeren überwachsen, was auf nährstoffreichem Boden unter zu viel Sonneneinstrahlung geschieht. Auch deshalb braucht das Fällen grosser Bäume Augenmass. Natürlich nachwachsen soll indes vor allem Laubholz und Weisstannen. Diese werden nicht vom Borkenkäfer befallen und sind weniger sturmanfällig als Rottannen. Die Zeiten der grossflächigen Monokulturen mit Rottannen, wie sie bis in die 1970er noch angepflanzt wurden, sind vorbei. Was davon heute noch steht, wird über die nächsten Jahrzehnte langsam aber sicher verschwinden und zu gut durchmischten Dauerwäldern werden.
Junge in Konkurrenz mit dem Wild
Bei Aufforstungen setzt man aber nicht nur auf den Jungwuchs, sondern setzt auch gezielt Bäume. Darunter Douglasie, eine Tannenart aus Nordamerika, die sich besser für das auch hier wärmer werdende Klima eignet. Doch bis sie gross genug sind, müssen die Schösslinge vor dem Verbiss durch Rehe geschützt werden. Die Stadtförster machen dies meistens mit Gattern, die man allenthalben auf dem Hönggerberg sieht. Die Privaten schützen die einzelnen Bäume eher mit Gitternetzen, bis sie der Frasshöhe des Wildes sicher entwachsen sind.
Man habe, so Heusser, speziell im Käferberg ein Problem mit dem Wild, der Frass-Druck sei gross. Weisstannen kämen ohne guten Schutz kaum hoch im hiesigen Wildschongebiet. An der Stadtgrenze beim Rütihof gehe es noch, doch je weiter in Richtung Käferberg, desto mehr Rehe habe es offenbar. Dass die Rehe mehr an Bäume gehen, hat auch damit zu tun, dass sie durch die vielen Menschen und Hunde im Wald immer mehr gestört werden und sich auf schnell verfügbare Nahrung «stürzen», anstatt irgendwo gemütlich Gras zu äsen. Baumschösslinge, Triebe und sogar die Rinde, die sie mit ihren Geweihen «fegen», also aufreissen und dann abfressen, bieten sich da geradezu an.
Nachhaltigkeit als Generationenprojekt
Wie die Überführung von früheren Monokulturen in einen gesunden, dauerhaften Mischwald ein Generationenprojekt ist, so ist auch der private Waldbesitz eine Familientradition. Heusser war schon als Kind, damals noch mit dem Pferdefuhrwerk, fast jeden Samstag mit seinem Vater im Wald. Nicht immer zu seiner Freude, wie er gesteht. Als er später aber den Holzerkurs besuchte, fand er den Zugang. Der Wald fasziniert ihn bis heute, es sei eine andere Welt hier draussen in der Natur: Das Resultat der Arbeit zu sehen und über die Jahre zu beobachten, wie sich der Wald entwickelt. Und sich bewusst zu sein, dass er selbst von den meisten Bäumen, die er gross werden lässt, keinen Nutzen haben wird, sondern erst die nächsten Generationen – so wie er heute die Früchte der Arbeit seiner Vorfahren erntet. Ein langes Band der Verbundenheit spannt sich da durch den privaten Wald, von dem kaum je eine Parzelle auf den Markt gelangt. Auch Nikles bestätigt, dass die heutigen Waldbesitzer oft gerade an den Wäldern festhalten, weil schon ihre Grossväter diese bewirtschafteten. Damals sei Wald auch eine Art Notreserve gewesen: Stand auf dem Hof eine Investition an, trug der eine oder andere gute Baum aus dem eigenen Wald zur Finanzierung bei. So blieb Nachhaltigkeit, zum Schlagwort der Wirtschaft verkommen, im Wald noch konkret erlebbar. Heusser zeigt auf einen Waldabschnitt, wo an Rottannen die unteren Äste abgesägt werden. «Wertasten» heisst diese mit Leitern bis hoch hinauf ausgeführte Arbeit, weil so die Astlöcher minimiert werden und der Stamm als Furnierholz dienen kann, der wertvollsten Verarbeitungsmethode – doch auch diese Ernte wird nicht Schaggi Heusser der IV., sondern erst seine Nachkommen einfahren. Vorausgesetzt der Borkenkäfer oder ein Sturm kommen ihnen nicht zuvor.
Nutzen mit Verständnis
Wie aller Wald ist auch der Privatwald öffentlich zugänglich. Jederzeit, und das wird heute auch von teilweise kommerziellen Waldschulen genutzt. Eigentlich müssten die Waldbesitzer dafür um Bewilligungen angegangen werden, doch so lange – was meistens der Fall ist – die Nutzung schonend geschieht, sind die Besitzer gar nicht besonders interessiert, Bewilligungen erteilen zu müssen oder sogar Geld für die Nutzung zu erhalten, denn das würde sie möglicherweise in Haftungspflicht nehmen. Der Besitzer könnte zum Beispiel für Verletzungen und Schäden durch herunterfallende Äste haftbar gemacht werden. Mit der freien Nutzung ist der Benutzende selber haftbar und so lässt man die Waldschulen allgemein lieber machen.
Heusser fällt in den letzten Jahren aber etwas ganz anderes vermehrt auf: Mangelndes Verständnis der Leute für die Arbeiten im Wald. «Oft werden Warnschilder für Holzschlag missachtet, oder man wird sogar angefeindet. Man mache den Wald doch nur kaputt, anstatt ihn sich selbst zu überlassen», erzählt er. So wird er oft in Gespräche verwickelt, in denen er geduldig Auskunft gibt und erklärt, wie wichtig die Arbeit im Wald für alle ist, die ihn, den gesunden und ungefährlichen Wald, nutzen wollen.


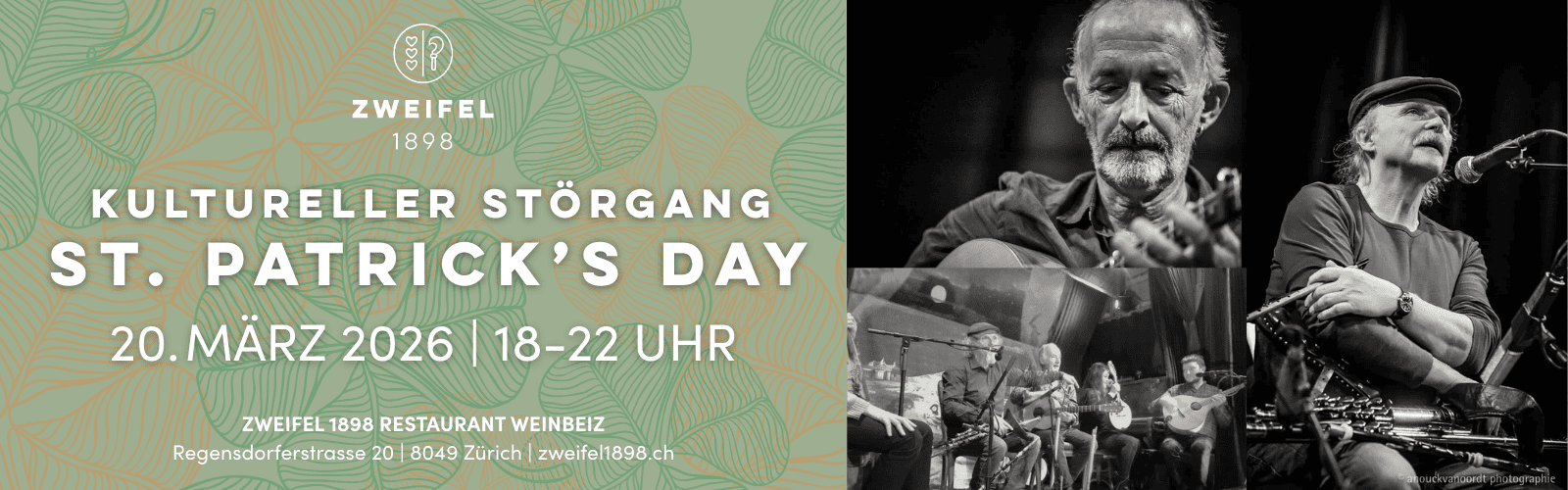


0 Kommentare