Expats
Mit den Augen der Anderen
Was sehen und empfinden Ausländer, wenn sie in die Schweiz, nach Zürich oder Höngg kommen? Wie gross ist der kulturelle Schock und wie überwindet man ihn? Kann man hier eine neue Heimat finden? Der Höngger hat verschiedene Geschichten und Einsichten gesammelt.
28. Februar 2018 — Patricia Senn
Als Christine M. Grimm vor etwas mehr als zwei Jahren nach Zürich zog, wusste sie gleich, dass sie «angekommen» war. Die Deutschamerikanerin hatte ihr Leben zwischen Süddeutschland und Kalifornien verbracht, konnte aber weder da noch dort richtig Wurzeln schlagen. In München gründete sie schliesslich eine Familie, ihr Sohn ist mittlerweile Post-Doktorand an der Harvard University in den USA. Vor drei Jahren lernte die lebhafte Klangtherapeutin, Musikerin und Übersetzerin die Schweizer Jodlerin Nadja Räss kennen, damals noch die Leiterin der «Klangwelt Toggenburg». «Die Schweiz hat eine lange Tradition mit Klang und Stimme, das war ein Zeichen für mich, dass ich hier am richtigen Ort bin», erzählt Grimm. Durch die Bekanntschaft mit Räss wurde sie selbst ein Teil der «Klangwelt Toggenburg». «Die Türen haben sich geöffnet», erzählt Grimm. Heute arbeitet sie als Klangtherapeutin in der Gemeinschaftspraxis «Silent Power» in Altstetten, über eine Klientin fand sie schliesslich eine Wohnung in Höngg. Dass sie selber sehr offen ist und auf die Menschen zugeht, hat ihr bestimmt geholfen. Doch vor allem die Sprache, davon ist sie überzeugt, spielt eine wichtige Rolle, um Anschluss an die hiesige Bevölkerung zu finden. Ausserdem hat sie auf der Plattform «Meet-up.com» eine Gruppe «English in Höngg» eröffnet, wo Gleichgesinnte ihrer Anglophilie frönen können – auch eine Möglichkeit, neue Leute kennenzulernen. «Ich habe mich in der kurzen Zeit schon sehr angepasst, meine Schweizer Freunde nerven sich fast, weil ich oft überpünktlich bin», sagt Grimm mit einem Augenzwinkern. Sie möchte in der Schweiz bleiben. Hat man die Welt einmal gesehen, sei es ein wenig wie in der Janosch-Geschichte «Oh wie schön ist Panama», wo die Tiere am Ende bei einer Hütte ankommen, die so schön ist, dass es das lang ersehnte Panama sein muss. Und dann merken, dass es in Wirklichkeit ihr altes Zuhause ist.
«Wie fühlt es sich an, Schweizerin zu sein?»
Amélie* wuchs in der Gegend von Paris auf und besass schon immer eine grosse Leidenschaft für die deutsche Sprache und andere Kulturen. Wenn Autos mit ausländischen Kennzeichen durch ihr Dorf fuhren, wünschte sie sich, sie würden anhalten und sie nach dem Weg fragen. Kaum hatte sie ihr Abitur in der Tasche, ging sie zum Studium nach Wien, in dieser Zeit lernte sie auch ihren Mann, einen Deutschen, kennen. Nach sechs Jahren in Österreich und einem kurzen Aufenthalt in Deutschland, ergab sich für ihn die Gelegenheit, in der Schweiz zu arbeiten. Drei Jahre, so hatten sie abgemacht, danach würden sie wieder nach Wien zurückkehren. Das ist nun 16 Jahre her und sie sind immer noch hier – seit 14 Jahren in Höngg. Dabei war der Anfang schwierig für die junge Lehrerin: «Ich arbeitete die ersten zwei Jahre an der Rudolf-Steiner-Schule im Zürcher Oberland», erzählt sie in schnellem Deutsch. «Meine Lehrerkolleginnen und -kollegen waren alle schon älter und hatten bereits einen festen Freundeskreis, sie brauchten keine neue Freundin». Was sich ebenfalls als schwierig herausstellte, waren die vielen Regeln, vor allem beim Autofahren. «Ich wollte alles richtig machen, aber wie auch immer ich es anstellte, regelmässig erhielt ich diese Strafzettel», immerhin, mittlerweile kann sie darüber lachen. Und fühlt sich heute sogar freier, trotz, oder vielleicht gerade wegen der vielen Regeln. Es gäbe keine bösen Überraschungen und die Sicherheit sei nirgends so hoch wie hier, findet sie. Einmal in Höngg und mit einer neuen Anstellung an einer Bezirksschule im angrenzenden Aargau, fand sie schnell Anschluss, denn einerseits war das Kollegium ihrer neuen Schule grösser und jünger, andererseits leben in Zürich viel mehr Ausländer, die alle auch auf der Suche nach neuen Bekannten sind. Höngg ist in ihren Worten «genial»: «Man hat die Vorteile der Stadt und des Dorfes. Man kennt sich, kann alles zu Fuss machen», erzählt sie begeistert. «Ich habe mich noch nie so wohl gefühlt wie hier, und wir haben doch schon einiges von der Welt gesehen». Inzwischen hat sie einen grossen Freundeskreis, der sowohl aus Schweizerinnen als auch aus anderen Ausländern besteht. «Letztendlich geht es immer um die gemeinsamen Interessen, nicht um die Nationalität», davon ist Amélie überzeugt. Als Französischsprachige werde sie nicht oft mit Vorurteilen konfrontiert – die meisten Leute hören nicht, ob sie aus der Romandie oder Frankreich stammt. «Da haben es die Deutschen schon schwerer, die müssen sich viel öfter irgendwelche Sprüche anhören», weiss sie. Sie selber hatte keine wirkliche Vorstellung davon, wie es sein würde, in der Schweiz zu leben. Einmal hier, überlegte sie sich, wie es sich wohl anfühlt, Schweizer zu sein. «Welche Sprache sprechen sie in der Fussball-Nationalmannschaft? Welche Identität hat ein Schweizer in einem Land mit vier Sprachen?», solche Fragen interessieren sie. Mittlerweile hat sie eine Ahnung, was die Antwort sein könnte: «Man ist hier in erster Linie sich selber. Und dann ist man noch Schweizer». Seit letztem Sommer haben auch Amélie und ihre Familie den roten Pass. «Wir finden es wichtig, am politischen Leben teilzunehmen. Meiner Meinung nach ist es eine riesige Chance, dass die Bevölkerung hier so oft mitreden kann. Ausserdem sind unsere Kinder hier aufgewachsen, sie gehören hierher. Die Vorstellung, dass sie plötzlich in ein Land ausgewiesen werden könnten, zu dem sie gar keinen Bezug haben, finde ich beängstigend», gesteht die lebhafte Persönlichkeit.
*Name der Redaktion bekannt
«Wir sind alle gleich»
Überhaupt keine Probleme mit den «gesesetzestreuen» Schweizern hatte hingegen Adriana, als sie mit ihrem Mann vor acht Jahren in die Schweiz kam. Im Gegenteil, die gebürtige Rumänin sieht viele Gemeinsamkeiten mit ihrer eigenen Mentalität. Eine Gesellschaft funktioniere ja erst, wenn sich ihre Mitglieder an gemeinsame Regeln hielten. Als junge Frau ging sie als Au-pair nach Chicago und merkte dort zum ersten Mal, was es bedeutet, wenn die eigenen Zeugnisse und Diplome – sie hatte Pädagogik studiert – nicht anerkannt werden. Also drückte sie noch einmal die Schulbank, um sich im Bereich Kinderbetreuung weiterzubilden. Sie lernte aber auch, dass alleine ihre Fähigkeiten wichtig waren, nicht ihre Herkunft: «Wir sind alle gleich, selbst wenn sich unsere Kulturen unterscheiden, die Liebe zu den Kindern verbindet uns», davon ist sie überzeugt. Als ihr Mann schliesslich für sein Studium nach St. Gallen gehen wollte, sah sie den Zeitpunkt gekommen, ihren langjährigen Traum einer eigenen Kinderkrippe zu verwirklichen. Vor 3,5 Jahren war es schliesslich so weit: Das KiddieLand in Wipkingen eröffnete, viele Expats – aber auch Schweizer Paare – nutzen die familiäre Einrichtung. «Oftmals leben die Grosseltern weit von den Enkeln entfernt und können deshalb nicht auf sie aufpassen, wenn die Eltern zur Arbeit müssen. Sie brauchen deshalb einen Ort, der diese Aufgabe übernimmt und auf den sie sich verlassen können. », erklärt Adriana. Vielleicht liegt auch hier ein Grund dafür, dass sie nichts gegen Regeln hat: Ohne einen strikten Plan herrschte bei so vielen verschiedenen involvierten Menschen und Ansprüchen das Chaos. Auch, dass man das Vertrauen der Zürcher erst gewinnen muss, entspricht ihren eigenen Einstellungen: «Alles basiert auf Vertrauen, auch meine Arbeit». Sie sagt von sich selber, dass sie die Menschen liebt, und stellt auch öfter fest, dass die Leute sich über ein kurzes Gespräch sehr wohl freuen, wenn man sie erst einmal angesprochen hat. Sie muss schon sehr lange nachdenken, bis ihr etwas einfällt, dass man kritisieren könnte: «Manchmal sind die Schweizer etwas unflexibel, sie können sich nicht so gut an neue Situationen anpassen», meint sie, und fügt sogleich an: «das hat mich aber selber dazu motiviert, strukturierter zu werden und besser zu planen. Das scheint mir eine gute Ergänzung zu dem dynamisch-spontanen Zugang zu sein, den ich aus Rumänien und den USA gewöhnt bin».
«Die Schweiz hat mich gewählt»
Bei Adriana im KiddieLand arbeitet Hara. Nach ihrem Master in «Intercultural Education» für Kinder im Kindergartenalter zog es die Griechin ins Ausland, sie wollte andere Kulturen und Lehrmethoden kennenlernen. Also schrieb sie Dutzende von Bewerbungen, davon alleine 80 nach Deutschland, weitere 20 nach Schweden. «Nur drei davon gingen an die Schweiz, und alle drei Arbeitgeber haben mich zu einem Probetag eingeladen», erzählt die lebhafte junge Frau, «deshalb sage ich immer: Die Schweiz hat mich ausgewählt, nicht umgekehrt». Doch die erste Zeit im neuen Land war hart für sie: «Es war dunkel, wenn ich zur Arbeit fuhr, und dunkel, wenn ich wieder zu Hause ankam. Die Leute sind sehr arbeitsfokussiert, abends gingen alle meist gleich nach Hause. In Griechenland sind nach Feierabend alle auf der Strasse, man trifft sich, hat eine gute Zeit». Dazu kam der Deutschunterricht, der für viele so frustrierend ist, weil er ihnen beim Schweizerdeutschen nicht weiterhilft. Aber so gehe es wahrscheinlich allen, die ins Ausland gehen: «Man muss viel arbeiten, alles geben und auch Aufgaben übernehmen, die man zu Hause vielleicht nicht akzeptieren würde. In den ersten Jahren fühlte ich mich wie im Militär», erzählt Hara. Rückblickend findet sie aber, es sei auch eine gute Lektion gewesen. «Ich habe das Gefühl, ich wurde erst hier richtig erwachsen. Ich bin unabhängig, habe einen Job, bin für alles selber verantwortlich». Wie die meisten Expats hat auch sie einen multikulturellen Freundeskreis. «Es ist wahr, ich habe viele griechischen Freunde. Das hat nichts damit zu tun, dass ich die Schweizer nicht mögen würde oder sie nicht nett wären. Dadurch, dass Griechisch meine Muttersprache ist und mir auch die Mentalität und den Humor der Griechen näher ist, fühle ich mich in deren Anwesenheit einfach besser, vor allem wenn es mal nicht so gut geht». Auch wenn es zwei anstrengende Jahre waren, fühlt sie sich inzwischen sehr wohl in Zürich und schätzt es auch, dass alles so reibungslos funktioniert. «Die Menschen hier denken eher quadratisch: Es muss alles in diese Schubladen passen, dann läuft es gut. Wir Griechen sind eher «Rund-Menschen», es ist chaotischer. In Griechenland war es oft von der Laune des Angestellten abhängig, ob und wie schnell man an einem Schalter bedient wurde. Vielleicht sind wir dafür etwas fröhlicher. Eine Mischung aus beidem wäre vielleicht das Beste», sinniert Hara.
«Das Wichtigste ist, sich mit den richtigen Menschen zu umgeben»
Auch Clara erlitt einen kleinen «Schock», als sie mit ihrem Mann in die Schweiz kam, wie die Argentinierin lachend erzählt. «Es war Winter und die Leute waren so anders als in Südamerika», erinnert sie sich. Die Ingenieurin hatte das Gefühl, sie müsse sich zurücknehmen, um die Leute mit ihrer offenen Art nicht zu «überfallen», wie sie es nennt. Doch im Deutschkurs lerne sie Menschen in ähnlichen Situationen kennen und dadurch veränderte sich auch ihr Blick. «Ausserdem ist mein Mann Schweizer, so hatte ich von Anfang an Kontakt mit der hiesigen Bevölkerung. Heute setzt sich mein Freundeskreis aus einem bunten Mix verschiedener Nationalitäten zusammen». Als sie noch keine Kinder hatten, fehlte ihr in Höngg manchmal das soziale Umfeld, doch sobald der erste Sohn da war und sie die verschiedenen Angebote des GZ und anderen Organisationen nutzen konnte, änderte sich dieser Umstand sofort, «mit Kindern ist es automatisch leichter, den Anschluss zu finden», ist Clara heute überzeugt. Aber: Die Menschen hier öffnen sich nicht so schnell, das habe sie rasch gemerkt. Erst habe sie gedacht, dass die Schweizer grundsätzlich keine neuen Leute kennenlernen wollen, «heute weiss ich: Sie brauchen einfach mehr Zeit. Das akzeptiere ich und nehme es nicht mehr persönlich. Aber es war nicht immer einfach», erzählt Clara. Sie mag die Stabilität und Sicherheit im Land – im Zentrum von Buenos Aires könne man die Kinder nicht einfach bedenkenlos unbeobachtet lassen. Auch, dass sie kein Auto benötigt, um zum Beispiel zur Arbeit zu fahren, schätzt sie sehr. «Ich bin ein Fan des Öffentlichen Verkehrs, und hier funktioniert er auch», schwärmt sie. Dennoch, manchmal vermisst sie das Chaos ihres Herkunftslandes, das auch lustig sein kann. «Es lehrt einen, über sich selber zu lachen. Das fehlt den Schweizern ein bisschen. Etwas allgemein gesagt, führt der Hang zur Perfektion kombiniert mit dem fehlenden Selbst-Humor vielleicht dazu, dass die Leute hier weniger entspannt sind», formuliert sie vorsichtig. Die wichtigste Voraussetzung, um glücklich zu sein, sei ohnehin, sich mit den richtigen Menschen zu umgeben. Das sei auch ein Rat, den sie anderen Expats mitgeben würde: «Findet die guten Leute und lasst Euch nicht so schnell entmutigen. Auch wenn es frustrierend ist, nach einem Jahr Deutschunterricht an der Coop-Kasse zu stehen und völlig hilflos zu sein, wenn die Kassiererin fragt: <händsieessäckliwelle?>», sagt sie und lacht herzlich.
«Wie im Flughafen-Terminal»
Fast schon in den Genen hat Shanti* das Leben als Expat. Ihre Eltern stammen aus Indien, zogen aber nach Deutschland, und so wuchs Shanti in Köln auf, studierte Architektur an der RWTA Aachen und zog, nach ersten Berufserfahrungen, für eine deutsche Firma zuerst für drei Jahre nach Dubai und später nach Brüssel. Sie habe ein klassisches Expat-Leben geführt, sagt sie, und es sei durchaus aufregend gewesen in den Metropolen dieser Welt. Irgendwie aber auch wie in einem Flughafen-Terminal: «Das Leben ist geprägt von einer gewissen Hektik, es ist ein schnelllebiges Kommen und Gehen». So habe sie sich irgendwann nach Ruhe gesehnt, nach Entspannung und mehr Nähe zur Natur und den Bergen, nach einem Ort, der mehr ein Zuhause werden könnte, auch für eine Familie. Da ihr Partner bereits in Zürich lebte und arbeitete, beschloss man vor zwei Jahren, hier zusammenzuziehen. Vorausgesetzt, auch Shanti würde hier eine Stelle auf ihrem Beruf finden. Dabei half ihr ein Kontakt aus ihrer Zeit in Dubai: Ihren heutigen Chef hatte sie dort beruflich kennengelernt und so kam sie an die Stelle als Project Director Design Services bei einem internationalen Hotel-Konzern, der seinen Hauptsitz in Zürich hat. Als sie dann nach Zürich zog, war sie positiv überrascht, wie schnell sie, verglichen mit anderen Städten, bei der Anmeldung im Kreisbüro bedient wurde. Komplizierter werde es erst, wenn man sich hier beruflich selbstständig machen wolle. Die nötigen Zulassungen zu bekommen, sei sehr schwierig, das höre sie auch immer wieder aus ihrem Freundeskreis. Fast so schwierig sei es, trotz dem sehr guten Gesundheitssystem, einen Hausarzt zu finden. Als sie mal einen gebraucht hätte, habe es überall geheissen, man nehme im Moment keine neuen Patienten auf. Nur mit Glück habe sie einen Termin bekommen. Glück brauchte es auch bei der Wohnungssuche, und dass das Paar heute in Höngg wohnt, ist eher ein Zufall: Aus dem Freundeskreis kamen vor allem Empfehlungen für das Seefeld und Umgebung, «doch dann sind wir der Limmat entlang spaziert und haben Wipkingen und Höngg entdeckt», erinnert sie sich. Als eine passende Wohnung ausgeschrieben war, war sie bei der Besichtigung die einzige Deutschsprachige unter lauter Englischsprachigen. Seit dem Einzug schätzt Shanti die Ruhe hier, den Dorfcharakter mit allem Nötigen für den täglichen Bedarf in nächster Umgebung, die Nähe zur Natur und gleichermassen zur Stadt. Von Höngg wegziehen würde sie höchstens noch nach Wipkingen, weil das noch eine Spur lebendiger sei, denn bei aller Sehnsucht nach einem beschaulichen Leben, eine gewisse Betriebsamkeit, den 24-Stunden-Betrieb anderer Städte vermisst sie dann und wann doch, selbst an den Hotspots des Zürcher Nachtlebens: «Dubai zum Beispiel schläft nie, man trifft dort sieben Tage die Woche, auch nachts um drei noch überall Menschen». Und diese seien, so merkt sie kritisch an, schon generell aufgeschlossener als hier. Woran das liegt, darüber rätselt sie selbst. Vielleicht sei man sich in der Schweiz den Umgang mit Expats einfach noch nicht so gewohnt, wobei das für Zürich mit seinen vielen internationalen Konzernen eigentlich erstaunlich sei. Doch generell habe sie sich hier willkommen gefühlt, und beispielsweise beim Einkaufen werde man schnell wiedererkannt und nett gegrüsst. Bis man allerdings Kontakte zu Einheimischen habe, das brauche Zeit und sei ihr, selbst ein aufgeschlossener, positiver denkender Mensch, bis heute nicht gelungen. Selbstkritisch genug, hinterfragt sie auch ihren Anteil: Was könnte sie ihrerseits beitragen, um mehr Schweizerinnen und Schweizer kennenzulernen? Was müsste sie am eigenen Verhalten ändern? So überlegt sich die Sportbegeisterte zum Beispiel, einem Tennisverein beizutreten. Auch im Quartier würde sie sich gerne mehr engagieren, weiss aber nicht recht bei welcher Gelegenheit. Dass ihr berufliches Umfeld und der private Freundeskreis auch international ausgerichtet sind, ist natürlich auch nicht förderlich. Shanti ist Mitglied bei «InterNations», der weltweit grössten Expat-Gemeinschaft mit Vertretungen in 390 Städten, die alleine in Zürich rund 8000 Mitglieder zählt. Man tauscht sich aus, kann von wöchentlichen Aktivitäten profitieren, vernetzt sich – und bleibt trotzdem irgendwie unter sich, das ist ihr bewusst.
* Nachname der Redaktion bekannt
Anmerkung zur Personenauswahl
Auch Flüchtlinge und Sans-Papiers sind «Auswanderer» und durchaus ein Fokusthema wert. Sie wurden in diesen Artikeln jedoch nicht berücksichtigt, denn die Umstände und auch die betroffenen Akteure und Ämter sind unterschiedlich, die Thematik komplex. Die Personen, die sich in dieser Ausgabe für ein Porträt zur Verfügung gestellt haben, gehören zu der sogenannten «Neuen Migration», die vor einigen Jahren viele gut ausgebildete Arbeitskräfte nach Zürich und in die Schweiz brachte. Die «Alte Migration» betrifft die Einwanderer aus Spanien und Italien der 60er und 70er Jahre.



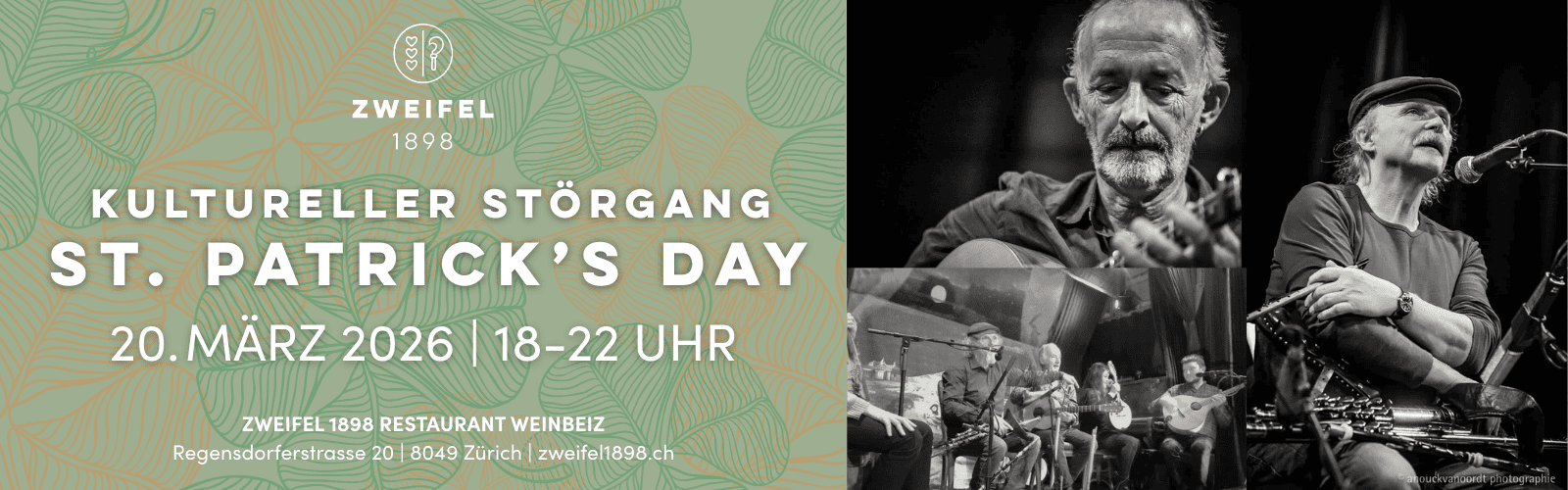

0 Kommentare