Apotheken
Letztlich zählt nur die Sicherheit
In der Stadt Zürich ist es den Arztpraxen seit sieben Jahren erlaubt, Medikamente abzugeben. Die Apotheken hatten sich jahrelang gegen die sogenannte Selbstdispensation der Arztpraxen gewehrt – doch zumindest im kleinräumigen Höngger-Apotheken-Alltag hat die Zusammenarbeit zwischen Apotheken und Arztpraxen nicht unter dem neuen Gesetz gelitten.
27. August 2019 — Fredy Haffner
Wenn es um die Zusammenarbeit zwischen Apotheken und der Ärzteschaft geht, erinnert man sich in Zürich schnell mal an den Streit zwischen diesen beiden Playern des Gesundheitswesens, der sich lange Jahre um die Frage drehte, ob Medikamente nur in Apotheken oder auch in Arztpraxen abgegeben werden dürfen. Wer Medikamente verkaufen darf, ist kantonal geregelt. So ist, zum Teil mit Ausnahmen, in 17 Deutschschweizer Kantonen die sogenannte Selbstdispensation, also die Abgabe von Medikamenten direkt durch die Arztpraxis, erlaubt, während sie in der Westschweiz und im Tessin nicht bekannt ist.
Auch im Kanton Zürich war die Selbstdispensation seit den 1950er-Jahren nicht gestattet, zumindest in den Städten Zürich und Winterthur nicht, um die dortigen Apotheken finanziell zu schonen. Im restlichen Kanton war sie indes unter gewissen Voraussetzungen – zum Beispiel einer Mindestdistanz zur nächsten Apotheke – erlaubt. Doch ab 2001 wurde mittels Volkinitiativen die Wahlfreiheit beim Medikamentenbezug gefordert, denen das Volk allen zustimmte. Erst im dritten Anlauf und mit einer Gesetzesinitiative gelang der Durchbruch, und seit Mai 2012 ist die Selbstdispensation im ganzen Kanton erlaubt. Wurde alles anders? Begrenzt: Ende 2013 gaben erst rund 20 Prozent aller Ärzte in Zürich und Winterthur selber Medikamente ab, und auch wenn der Anteil seither weiter angestiegen ist, so geht man doch nicht davon aus, dass er das Prozent-Niveau des restlichen Kantonsgebiet erreichen wird. Ein Grund, warum Arztpraxen darauf verzichten, ist der zusätzliche Aufwand.
Der damals heftig geführte Streit zwischen Ärzteschaft und Apotheken ist mittlerweile abgeflaut, auch wenn weiterhin auf beiden Seiten Studien und Publikationen kursieren, welche Nutzen oder Schaden der Selbstdispensation aufzuzeigen versuchen. Eine im Auftrag des Bundesamtes für Gesundheit (BAG) im Sommer 2013 durchgeführte Studie kam indes zum Schluss, dass Selbstdispensationspatienten in der Regel zwar niedrigere Medikamentenausgaben verursachen und häufiger Generika verschrieben bekommen, dafür aber die Ausgaben für ärztliche Leistungen höher sind, was letztlich dazu führe, dass die Selbstdispensation kaum einen Einfluss zu Lasten der obligatorischen Leistungen der Krankenkassen und deren Prämien habe.
Kritischer sind Bestellungen im Internet
Gefragt, ob der damalige Zwist heute noch ein Thema sei, antwortet Apothekerin Katharina Hermann von der Rotpunkt Apotheke und Drogerie Hönggermarkt mit einem zögerlichen Ja, schränkt aber dieses noch ein: «Es kam nicht so schlimm, wie man damals befürchtete. In Höngg stellen die meisten Arztpraxen Rezepte aus und einige, die selber Medikamente abgeben, fragen ihre Patienten und Patientinnen, ob sie die Medikamente gleich mitnehmen oder lieber in der Apotheke beziehen wollen». Das findet Hermann fair und hofft, dass dies auch in Zukunft, wenn Praxen in jüngere Hände übergehen, so bleibt.
Kritischer sieht die Apothekerin Medikamentenbezüge über das Internet, bei Online-Apotheken. Einige Krankenkassen fördern dies sogar über Prämienanreize. Gleich wie den Einkauf in nur einer bestimmten Apotheke. Nach Hermanns Einschätzung bewegen sich die Kassen damit in einem Graubereich, denn das Gesetz schreibe die freie Wahl der Medikamenten-Bezugsstelle ebenso vor wie die freie Arztwahl.
Die Kundschaft jedenfalls, so sagt sie, bevorzuge oft die Apotheke, weil dort ein weiterer persönlicher Kontakt stattfinde und damit auch das «Vieraugenprinzip» wirke: Je mehr Personen sich mit einer Verordnung auseinandersetzen, desto höher die Chance, Fehler rechtzeitig zu entdecken.
Im Alltag, so Hermann, frage sie mehrfach täglich irgendwo nach, ob eine Medikation korrekt sei.
Erfahrung und Daten bringen Sicherheit
Grossmehrheitlich, betont Hermann, laufe die Zusammenarbeit zwischen den Apotheken und den Arztpraxen, die Rezepte ausstellen, sehr gut. Bei Rezepten denkt man gerne mal an schwer entzifferbare Handschriften. Die Apothekerin schmunzelt: «Das ist weniger ein Thema als früher, da immer mehr Rezepte digital ausgedruckt werden». Sei etwas wirklich mal nicht lesbar, frage man eben nach. Nebst der Kundschaft, die mit den Rezepten direkt kommen, gelangen auch viele Rezepte per Mail oder Fax zur Apotheke. Auch jene, welche von den Kund*innen bei der Praxis bestellt werden, damit man die Medikamente dann nur in der Apotheke abzuholen oder sich liefern zu lassen braucht. «In Höngg sind wir zudem in einem Pilotprojekt, welches die Rezepte direkt aus dem Computersystem der Praxis in unseres übermittelt», erzählt Hermann. Das funktioniere gut, abgesehen von wenigen Kinderkrankheiten bei den Schnittstellen der Programme, und es vermindere potentielle Fehlerquellen. Daten über Kunden und Medikamente, ob nun so übermittelt oder sonst erfasst, müssen von den Apotheken während zehn Jahren gespeichert werden, um Rückfragen beantworten zu können. Doch sie sind nur lokal gespeichert, auch unter den vier Rotpunkt-Apotheken in Höngg hat man gegenseitig keinen Zugriff, übrigens auch nicht auf die Daten der Kundenkarten.
Wird ein Rezept eingelöst, prüft ein Interaktionsprogramm im Datensystem automatisch bis auf ein Jahr zurück abgegebene Medikamente mit dem neuen: auf Unverträglichkeiten oder pharmazeutisch unerwünschte Interaktionen. Wird etwas entdeckt, zeigt es dies der Apotheke an. Doch unabhängig davon wirft auch die Apothekerin einen prüfenden Blick auf die Medikation: «Wir fragen im Gespräch auch immer nach andernorts bezogenen Medikamenten, die ja von keinem System erfasst werden. Stossen wir auf mögliche Unverträglichkeiten, schauen wir genauer hin». So gibt es beispielsweise Medikamente, die man nicht zeitgleich einnehmen soll: «Schilddrüsenhormone und Kalziumpräparate zum Beispiel: Sind beide am Morgen verordnet, so schieben wir, auch ohne Rücksprache mit der Ärztin oder dem Arzt, das Kalziumpräparat auf den Mittag oder den Abend, das kann man auch dann einnehmen, wogegen das Schilddrüsenhormon eine halbe Stunde vor dem Frühstück eingenommen werden muss». Erkennt man in der Apotheke eine pharmakologische Wechselwirkung zweier Medikamente, so muss ein Anruf in die Praxis die Situation klären. Hermann nennt das Beispiel eines nur für ein paar Tage verordneten Antibiotikums, das sich nicht mit einer anderen Grundmedikation verträgt. So funktionieren gewisse Antibiotika etwa nicht mit Cholesterinsenkern, zum Beispiel Statin: «da muss man klären, ob nicht auch ein anderes Antibiotikum eingesetzt werden kann oder ob man, wenn der Krankheitserreger nur auf dieses bestimmte Antibiotikum reagiert, das Statin für die Dauer der Antibiose pausieren kann». Die Entscheidung liegt letztlich natürlich in ärztlicher Kompetenz, doch, so Hermann, um die Rückfrage und die gemeinsame Suche unter Fachpersonen nach einer Lösung seien die meisten Ärzt*innen froh.
Sie persönlich findet es sehr bereichernd, wenn sie mit der Ärzteschaft zusammenarbeiten und das Potenzial des vereinten Fachwissens ausschöpfen kann – der Zwist von damals scheint zumindest in Höngg begraben.
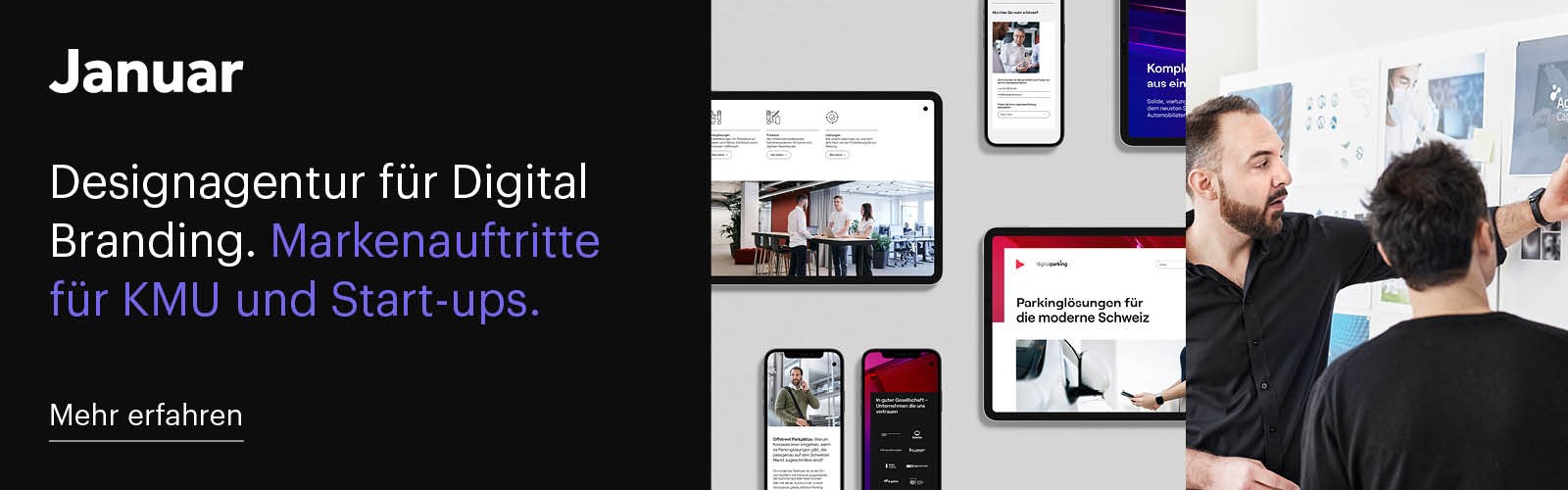



0 Kommentare