Aus der Wipkinger Zeitung
«In Wipkingen kennt man einander»
Daniel Jung hat eine Masterarbeit über Wipkingen geschrieben. Hier erzählt er, wie er den Wandel des Quartiers erlebt hat und wieso er nach der Pensionierung nochmals studierte.
26. September 2025 — Jina Vracko
Wir treffen Daniel Konrad Jung im «Nordbrüggli» und wir duzen uns auf Anhieb. «Ich hätte früher nie einen Fuss in dieses Lokal gesetzt», sagt er. Warum, wird er im Laufe des Gesprächs verraten. In diesem geht es um seine Masterarbeit – und Daniel ist immerhin schon über 60 Jahre alt. Nach dem Studium in Betriebswirtschaft war er einige Jahre in der Unternehmensberatung tätig, dann 30 Jahre in Verbänden und 25 Jahre davon bei GastroSuisse, dort zum Schluss als stellvertretender Direktor.
Ihm gefiel die Arbeit, doch er wollte nochmal etwas ganz anderes machen. Daniel entschied sich, den Master of Advanced Studies in «Applied History» zu absolvieren: «Angewandte Geschichte führt in die Gegenwart – das fand ich spannend.» Im Jahr 2021 begann das Studium, im Frühjahr 2025 war seine Masterarbeit vollbracht. Das Thema: Wipkingen.
Als gebürtiger Wipkinger erlebte er den Wandel vom – laut eigener Aussage – heruntergekommenen Viertel zum angesagten Quartier. «Meine Eltern hatten keine Freude, wenn wir Kinder damals ins GZ Wipkingen gingen. Da war der erste Robinsonspielplatz. Dort wollte man die Kinder vor dem Autoverkehr schützen und ihnen einen Raum geben, wo sie sich ausleben konnten. Diese Gedanken waren sehr progressiv», erzählt Daniel.

Von der vierten bis zur sechsten Klasse besuchte er die Schule Waidhalde: «Man begann dort die Kinder mehr zu aktivieren und in den Dialog mit ihnen zu treten. Zuvor war der Schulunterricht fast militärisch.»
Die Masterarbeit beschreibt die Geschichte von Wipkingen bis in die Gegenwart. Das Quartier sei ein Brennpunkt der Spannungsfelder im öffentlichen Raum. «Wipkingen ist das Labor vom Stadtrat», meint Daniel. «Hier beim Bahnhof liegt die sogenannte Begegnungszone, nur 300 Meter weiter die Westtangente. Dieser Kontrast, das ist Wipkingen.»
Eine von zahlreichen Entdeckungen, die Daniel in seiner Arbeit festhält, ist die Geschichte der Siedlung Lettenhof, einer Wohngenossenschaft für alleinstehende, berufstätige Frauen: «Diese Überbauung wurde im Jahr 1927 von Lux Guyer erstellt», sagt er. Innovative Innenausstattung, Südorientierung mit Balkonen, Waschküche und Telefonanschluss – die Siedlung war einzigartig. «Das ganze Raumkonzept hat sie neu gedacht, alles aus der Sicht einer Frau. Das bedeutete viel – damals war es sicher nicht einfach, als alleinstehende Frau zu leben.»
«Wipkingen ist immer ein Spiegel»
Anhand der Geschichte von Wipkingen analysierte Daniel die urbane Entwicklung im Allgemeinen. Im Vorwort schreibt er: «Auf die Landflucht folgte eine Stadtflucht und schliesslich wieder in entgegengesetzter Richtung.» In den 1990er-Jahren nahm Daniel den Einwohnerverlust in seinem Quartier stark wahr, die Statistik bestätige das: «30 Prozent ist massiv. Erst 2010 kam der Wendepunkt und die Bevölkerungszahl in Wipkingen stieg wieder an.»
In der Arbeit ist ebenfalls beschrieben, welch verheerende Auswirkungen die Schliessung der Drogenszene auf dem Platzspitz für Wipkingen hatte: Die Szene verlagerte sich zum oberen Letten. Erst als 1994 die Drogenabgabe für Schwerstsüchtige eingeführt wurde, entspannte sich die Situation und das Gebiet konnte neugestaltet werden
Daniel und seine Frau, inzwischen in Höngg wohnhaft, erhielten im Jahr 1998 einen Tipp über ein Restaurant beim Lettenareal. «An einem Abend schlichen wir im Dunkeln dort hin. Plötzlich sahen wir die Lichter: Das war die erste Version vom ‹Primitivo› – es war ein kleines Paradies.» Dies war der Anfang der Entwicklung des oberen Letten zum «Sommer-Hotspot schlechthin», wie Stefan Tamò, der das «Primitivo» damals konzipierte und betrieb, in der Arbeit von Daniel zitiert wird.
Er hatte zuvor das «Josef» übernommen und es inmitten der Drogenszene zur beliebten Beiz transformiert. Solche jungen, innovativen Unternehmer waren wichtig für die Entwicklung des Quartiers, betont Daniel: «Das Nordbrüggli betrat man nicht, es gingen seltsame Gestalten ein und aus. Dann brachte ein Unternehmer das Lokal moderat auf Vordermann und bewahrte dabei dessen Charme. Es ist eine Win-win-Situation für alle Beteiligten.»
Das Rezept für Wipkingen
Wird die Stadt attraktiver, so wird das Wohnungsangebot aufgewertet, was oft eine Verdrängung von wirtschaftlich Schwächeren aus der Innenstadt bedeutet, schreibt Daniel in seiner Arbeit. Dieser Vorgang, die «Gentrifizierung», sei in Wipkingen eher moderat vonstatten gegangen.
Nicht nur weil es wenig Landreserven gab, auf denen Neubauten erstellt werden konnten, wie er erklärt: «Wipkingen ist ein Opfer der Verkehrs- und Drogenpolitik. Eventuell sind aus diesem Grund keine grossen Investoren gekommen, so wurde eher sanft renoviert.» Dies hat langanhaltende Auswirkungen auf den Wohnraum: «In Wipkingen war 2023 annähernd jede dritte Wohnung Eigentum einer Genossenschaft oder der öffentlichen Hand», sagt er.
Zu den drei Faktoren «neue Mittelklasse», «moderate Gentrifizierung» und «unternehmerische Persönlichkeiten», kommt der Gemeinschaftsgeist in Wipkingen, so Daniel: «Die Stadt steht für Anonymität, aber in Wipkingen kennt man einander, man ist schnell per du.»
So war das auch mit Beni Weder, Präsident des Quartiervereins Wipkingen, mit dem er sich für die Arbeit austauschte. Die Publikationen von Martin Bürlimann und Kurt Gammeter dienten Daniel als wertvolle Basis – Bürlimann übernahm zudem das Lektorat der Masterarbeit.
Schliesslich möchten wir wissen, was sich Daniel für die Zukunft des Quartiers wünscht. Sein Anliegen ist der Verkehr: «Man muss das Problem nicht mit Verboten, sondern mit Technologie lösen. Es gibt Situationen, wo es das Auto braucht, auch das Gewerbe ist darauf angewiesen. Ich finde die dogmatische Politik der Stadt nicht gut – es braucht ein Miteinander, nicht ein Ausschliessen vom Autoverkehr – auch in den Verkehrsmitteln braucht es Diversität.»


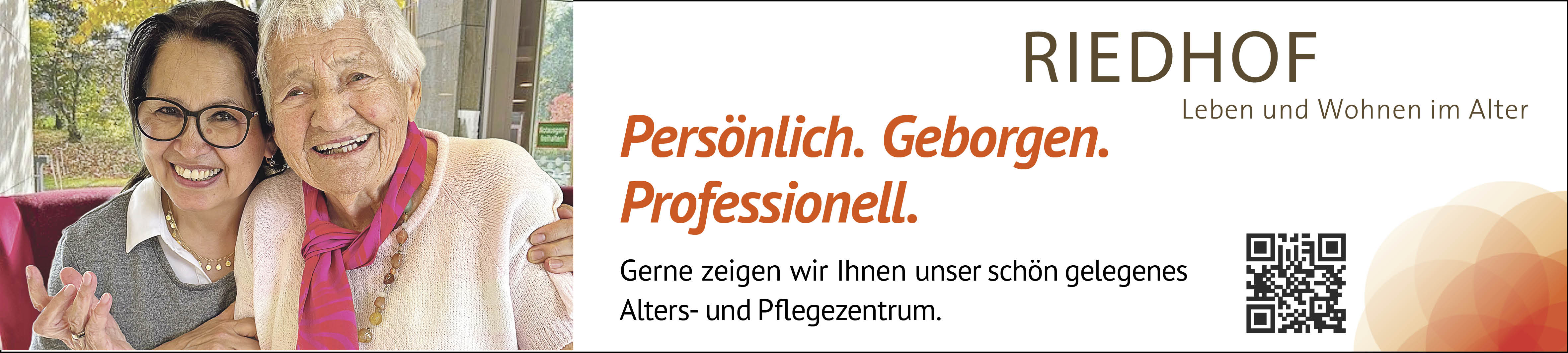
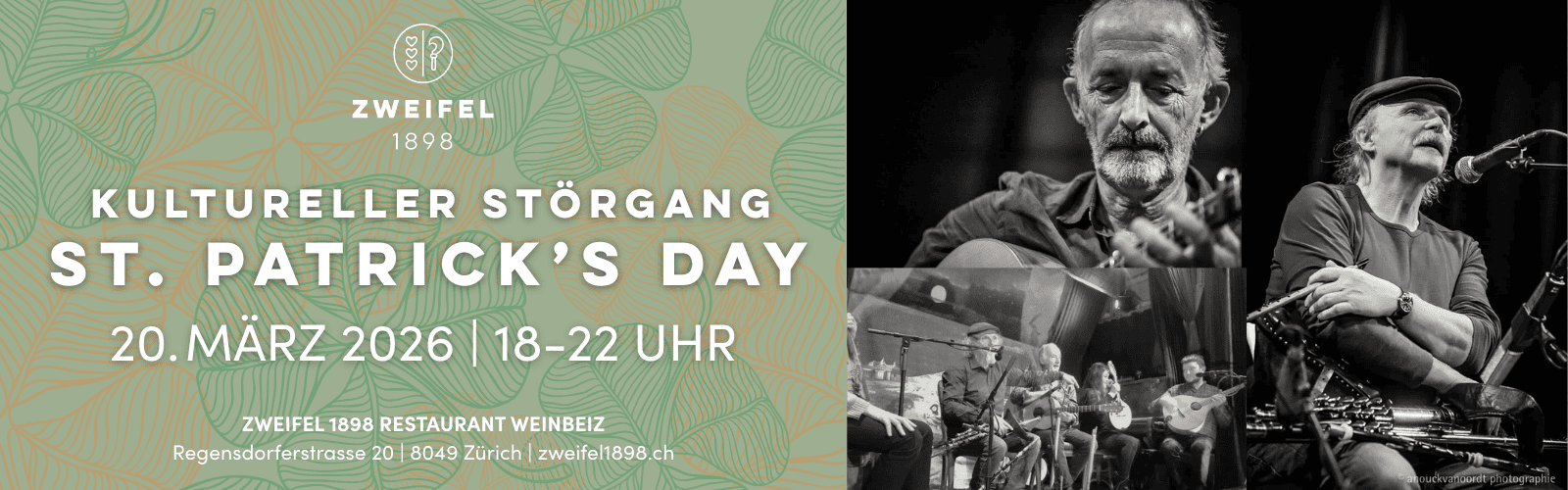

0 Kommentare