Quartierleben
Hönggerberg, (m)ein Waldparadies, Teil 1
Ob Emil Aeberli, im November eben 94 geworden, als Einziger im «Höngger» vom 1. April die nicht erfundenen Artikel erkannt hatte? Er schrieb sie jedenfalls als Einziger auf einer Postkarte an den «Höngger» und gewann damit einen Freiwunsch für einen redaktionellen Beitrag. An einem der letzten Herbsttage «überreichte» der «Höngger» endlich den Gewinn.
25. November 2010 — Fredy Haffner
Noch im April angefragt um seinen Wunsch, schrieb Emil Aeberli, der seit 15 Jahren in der Tertianum-Residenz Im Brühl zuhause ist, einen Brief voller Ideen zum Thema «Waldparadies Hönggerberg». Selbst gerne und oft dort unterwegs, hatte er viele Fragen zu Fauna, Flora, Waldwirtschaft und Freizeit im Hönggerwald, die er alle gerne mit einer Fachperson auf einem Spaziergang besprochen hätte. Der «Höngger» lud deshalb Max Ruckstuhl, selber Höngger und bei Grün Stadt Zürich Leiter der Fachstelle Naturschutz, zu einem gesprächigen Vormittag in «Aeberlis Waldparadies». So traf man sich dann am Morgen des 5. Novembers beim Restaurant Schützenhaus und zog dem Waldrand entlang in Richtung Zielhang des 300-Meter-Schiessstandes los. Die eine Hälfte der bunten Blätter hing noch an den Ästen, die andere raschelte unter den Füssen. Sofort waren die beiden Herren in ein angeregtes Gespräch vertieft. Beobachtungen, Fragen und Anekdoten des einen wechselten sich mit Gedanken und Fakten des anderen ab. Auf der Kappeliholzstrasse ging es hinein in den Wald, vorbei an einer acht Meter über dem Boden gekappten Eiche. «‹Bioholz› nennen das die Förster», beantwortete Ruckstuhl die entsprechende Frage Aeberlis. Solche Stämme leisten als Heimat und Nahrungsquelle für zahlreiche Lebensformen wie zum Beispiel Spechte einen wichtigen Beitrag zur Artenvielfalt. Dass Bäume noch einen anderen Wert haben als bloss den finanziellen, zu dieser Einsicht gelangte man erst in den letzten Jahrzehnten. Mit dem Blick über den dicht bewachsenen Waldboden schweifend, erinnerte sich Emil Aeberli daran, wie dort in den Kriegsjahren kaum ein Ast lag: Bis hin zu Tannzapfen wurde alles zum Heizen verwendet. Viele Wohnungen wurden damals mit einzelnen Gusseisenöfen geheizt. «‹Schützegrabe-Öfeli› nannten wir diese», erinnerte Aeberli sich, «weil deren Urform von den Soldaten in den engen Schützengräben verwendet worden war. Sie passten in jede Mietwohnung: Ein Loch ins Fenster geschnitten für das Kaminrohr und schon wurde alles, was brennbar war, verheizt.» Aus heutiger Sicht, im Zeitalter strenger Luftreinhalteverordnungen, mutet einen die Erinnerung des Zeitzeugen seltsam an, der sagt: «Was heute die Parabolantennen vor bald jedem Fenster, das waren damals die Kamine der kleinen Zimmeröfen.»
Wald als Energielieferant
Das Thema «Wald als Energielieferant» ist heute wieder aktuell. 5,7 Millionen Kubikmeter Holz werden in der Schweiz jährlich genutzt – 3,7 Millionen davon zur Energiegewinnung. Max Ruckstuhl erklärte neben einem riesigen Haufen aus Baumkronen am Wegrand: «Das ist alles kein Sägereiholz, sondern solches, das hier vor dem Abtransport noch etwas trocknet. Bevor es zu Holzschnitzeln verarbeitet wird, dient es hier Vögeln wie dem Zaunkönig gerne als Versteck- und Nistplatz.» Auf dem Weg weiter hinunter zum Waldweiher kam das Thema «Hausmüll im Wald» auf. «Überall, wo man mit dem Auto zufahren kann, wird Abfall deponiert», sinnierte Aeberli, doch Ruckstuhl berichtete, dass dies in Höngg kein grosses Problem sei. Doch wie war das früher? Aeberli, aufgewachsen auf einem Bauernhof im zürcherischen Erlenbach, erinnert sich gut an etwas, das auch in Höngg, im Wettingertobel zum Beispiel, einfach alltäglich war: Was nicht mehr gebraucht wurde, warf man wortwörtlich gleich hinter dem Haus «den Bach hinunter». Im Unterschied zu damals bleibt der «moderne» Abfall in der Natur über Jahrhunderte liegen – PET-Flaschen, so zeigen Berechnungen, bis zu 1000 Jahre. Da braucht die Blechdose mit 100 Jahren direkt wenig Zeit, bis sie zersetzt ist. «Abfall» natürlicher Art sammelte sich auch im Weiher an, bei dem man nun angelangt war. 1986 angelegt, drohte er langsam zu verlanden. Auch hatten sich standortfremde Arten wie Goldfische, die leider immer wieder ausgesetzt werden, festgesetzt. Sie überleben, im Schlamm vergraben, selbst harte Winter und machen sich im Frühling über den Laich von Amphibien her. Also muss von Zeit zu Zeit eingegriffen werden. Grosse Bagger hatten unlängst tonnenweise Schlamm und Totholz entfernt – eine «Radikalkur», die bei Spaziergängern Fragen aufgeworfen hatte. Doch die Natur hat diese unterdessen selbst beantwortet: Im kleinen Stehgewässer ist die Artenvielfalt wieder sicht- und hörbar. Selbst jetzt im Herbst ist noch ein Stockentenpaar zugegen, als würde es bereits den Nistplatz für den nächsten Frühling rekognoszieren. Die Gegend um den Weiher wird auch von vielen anderen Wildtieren gerne besucht, selbst Wildschweine wurden hier nachts schon gesichtet: «Sie ziehen vom Gubrist her kommend bis vor die ETH», erzählte Ruckstuhl, «dort scheint bislang die Grenze zu sein, wahrscheinlich ist die breite Strasse und der Gebäudekomplex ein zu grosses Hindernis für sie.» Doch das Schwarzwild ist äusserst scheu und Sichtungen selten.




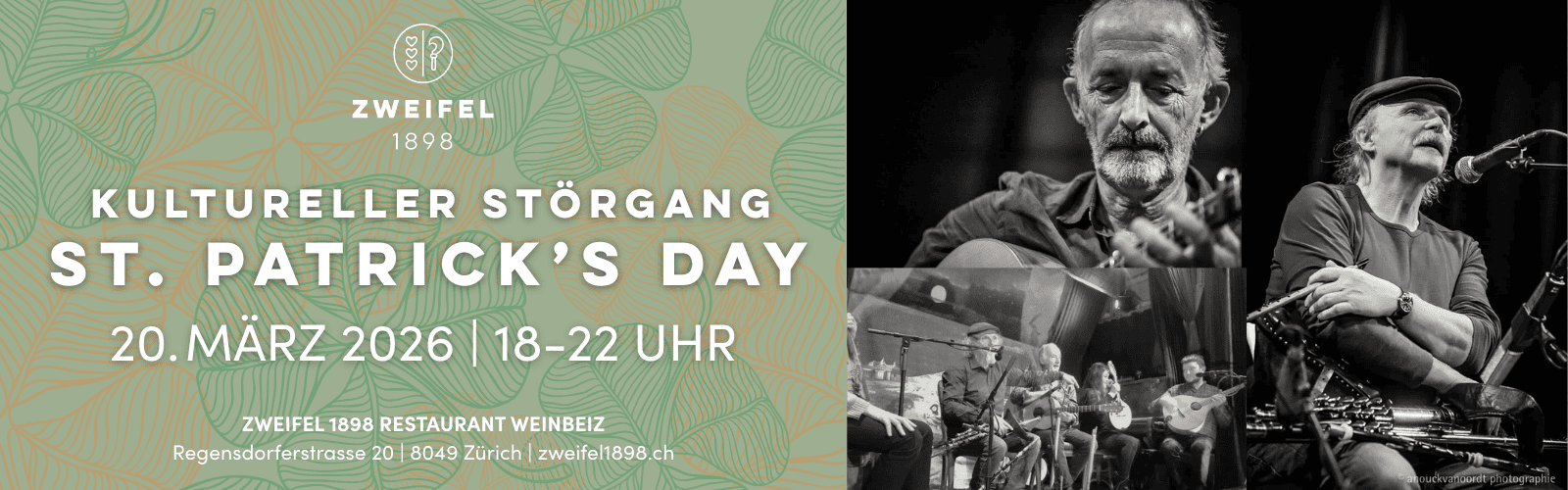
0 Kommentare