Höngger Wald
Herr des Waldes
Der Hönggerwald hat viele Funktionen: Er schützt, dient der Erholung und der Holznutzung. Revierförster Emil Rhyner und seine Abteilung schauen dazu, dass das auch so bleibt.
7. November 2018 — Patricia Senn
38 Jahre arbeitet Emil Rhyner bereits als Förster bei der Stadt Zürich, seit 1999 ist er Revierförster des Waldreviers Nord. Er hat die Hoheit über 1200 Hektare, ein Gebiet, das sich von der Stadtgrenze in Zollikon bis zum Katzensee erstreckt. Der Hönggerberg gehört dazu. 18 Personen arbeiten mit ihm in seinem Fachbereich, darunter Lernende und Teilzeitangestellte. Ein gewöhnlicher Tag beginnt um sechs Uhr, um sieben ist Mitarbeiterbesprechung. «Ich verbringe etwa die Hälfte der Zeit draussen, die andere benötige ich für Büroarbeiten», erzählt der Revierförster, als der «Höngger» ihn auf dem Platz vor dem Schützenhaus trifft. Grün Stadt Zürich hat den kleinen Waldumgang arrangiert. Was genau macht so ein Förster eigentlich? Kann man den Wald nicht einfach wachsen lassen?
Die Arbeiten eines Försters sind sehr vielseitig: Er plant die Waldpflege auf zehn Jahre hinaus, berät Privateigentümer und Kooperationen und ist dafür verantwortlich, dass das Waldgesetz eingehalten wird. Im Wald selber zeichnet er an, welche Bäume gefällt werden müssen, vermisst das Holz, verkauft es. Neben viel Erfahrung ist ein gutes Vorstellungsvermögen sehr wichtig, wenn man Holz anzeichnet: «Man muss sehen können, welche Auswirkungen es auf die direkte Umgebung hat, wenn ein Baum rausgenommen wird, nicht nur visuell», meint Rhyner.
Der forstwirtschaftliche Teil macht etwa einen Drittel der Arbeit seines Betriebes aus, die restliche Zeit fliesst in die Instandhaltung der Wege und Strassen, den Bau und Erhalt von Waldhütten, Tischen und Feuerstellen, die Pflege der Finnenbahnen und der Biketrails, und alles was im Wald sonst noch ansteht an Bau- und Unterhaltsarbeiten. Obwohl der Wald viele verschiedene Funktionen hat, wie die Holznutzung, den Schutz der Stadt oder auch die Erhaltung der biologischen Vielfalt, ist seine Bedeutung als Erholungs- und Naturerlebnisraum eine wichtige. Das wird auch auf der Fahrt durch den Wald deutlich: Ein Vater braust mit Kinderanhänger am Fahrrad über die Strasse Richtung ETH, eine Gruppe von Nordic Walkern kommt im zügigen Schritt vorbei und grüsst den Revierförster, Jogger und Spaziergänger sind schon früh unterwegs.
Alle sechs Jahre rundum gepflegt
Die Stadt hat das Ziel, den Wald nach den Prinzipien des naturnahen Waldbaus, auch Dauerwald genannt, zu bewirtschaften. Das bedeutet, dass vor allem Baumarten, die der natürlichen Waldgesellschaft entsprechen, gefördert werden. Zurzeit sind rund zwei Drittel der Bäume Laubbäume, der Rest sind Nadelbäume. Ziel ist eine Entwicklung zu einem artenreichen Mischwald. «Um dem Klimawandel entgegen zu treten, wird man zwangsläufig nicht-heimische Baumarten dazu nehmen müssen», schätzt der Revierförster.
Im Hönggerwald wird jedes Jahr eine Fläche von rund 16 Hektaren bewirtschaftet. Das bedeutet, dass nach sechs Jahren der ganze Wald einmal komplett gepflegt wurde. «Wir entfernen jeweils die Holzmenge, die in dieser Zeit gewachsen ist. Es handelt sich dabei um Bäume in allen Entwicklungsstadien, von den kleinen bis zu den ältesten, die bis zu 200 Jahre alt werden – die Erfahrung zeigt, dass die meisten Eichen und Buchen ihr Lebensende dann leider erreicht haben.
Wenn ein Baum ökologisch wertvoller ist als ökonomisch, lässt man ihn stehen und überlässt ihn dem natürlichen Zerfall, erklärt Rhyner die Vorgehensweise. Aus der Hauschicht des Mittelwaldes und allen minderwertigen Holzsortimenten aus den übrigen Holzschlägen wird Brennholz, welches unter anderem als Hackschnitzel an die Spitäler Waid und Triemli geliefert wird. Über Zürich Holz gelangen die Hackschnitzel an den Zoo Zürich und das Holzheizkraftwerk Aubrugg in Wallisellen. Auch Totholz ist wertvoll, denn es bildet ein wertvolles Biotop und Lebensraum für Tiere und Pilze. «Solange die toten Bäume kein Sicherheitsproblem darstellen, lassen wir sie stehen», sagt Rhyner. Wenn sie zu nahe an einer Strasse stehen, stossen wir sie wenn möglich um, lassen sie dann aber liegen. Es sei eine sanfte Art der Waldpflege.
Im Dauerwald würden keine grossen Flächen geschlagen, sondern nur Einzelstammnutzung betrieben. Dasselbe gilt für das ganze Waldrevier Nord und die meisten Wälder auf Stadtgebiet. «Im Waldrevier Nord können wir meistens alles mit konventionellen Forstmaschinen bewältigen, nur dort wo beispielsweise aus Sicherheits- oder Platzgründen der Baum nicht auf konventionelle Art gefällt werden kann, kommt manchmal ein Helikopter oder Seilkran zum Einsatz. Bei schwieriger zugänglichen Wäldern, wie am Uetliberg mit seinen extrem steilen Partien und geringerer Zuwachsleistung, wird in längeren Zeitabständen eingegriffen.
Klimawandel macht sich bemerkbar
Es gibt vieles zu beachten, wenn man einen Wald pflegen will: So müssen die Lichtverhältnisse im Gleichgewicht sein, damit die Jungpflanzen am Boden überhaupt wachsen können. Manche Bäume dienen auch als «Helfer»: Sie geben anderen Windschatten und sorgen für die richtige Waldinnentemperatur. Gegen höhere Gewalten, wie einen Sturm, sind aber auch die Förster machtlos. Der Revierförster zeigt durch die Windschutzscheibe auf eine Lichtung mitten im Wald, wo der Sturm Lothar im Dezember 1999 ein grosses Loch hinterlassen hat, das jetzt mit jungen Bäumen bestockt ist. «Die Natur findet die Schwachstellen, diese werden entsprechend immer wieder angegriffen».
Dann gibt es Sorten, die mehr Unterstützung brauchen, damit sie gedeihen können. So wie die jungen Eichen, die ohne Schutz dem Rehverbiss zum Opfer fallen würden. «Die Eiche ist ohnehin nicht die Stärkste, und würde ohne Hilfe schnell von anderen Baumarten verdrängt werden». Überhaupt: Liesse man den Wald wachsen, wie er wollte, würde in ein paar Jahrzehnten nur noch die dominante Buche überleben. Gerade die Eiche, aber auch die Weisstanne, mit ihren tiefen Pfahlwurzeln, werden aber in Zukunft wichtig sein, da sie auch grosse Trockenheit aushalten. «Die zwei Grad Klimaerwärmung machen sich bemerkbar», meint Rhyner, «wenigstens haben wir hier noch genügend Niederschlag, aber eine Jahresdurchschnittstemperatur von zehn Grad ist für manche Bäume schwer zu verkraften». Wie sehr der trockene Sommer den Bäumen tatsächlich zugesetzt hat, wird sich erst im Frühling zeigen.
Neben den erhöhten Temperaturen macht vor allem der Käfer- und Pilzbefall den Bäumen zu schaffen. Die Eschen leiden seit etwa zehn Jahren am Eschentriebsterben, verursacht durch einen Pilz, der aus Asien eingeschleppt wurde. Rhyner deutet auf einen noch dünnen Baum, dessen Blätter bereits braun geworden sind, «das ist nicht der einsetzende Herbst, sondern wird vom Pilz verursacht». Eschen machen rund elf Prozent des Waldes aus, wenn diese fehlen, wird das auch für Laien sichtbar. Die Fichten, die 30 Prozent des Baumbestands stellen, sind die Lieblingsbäume des Borkenkäfers, auch «Buchdrucker» genannt. Dieses Jahr hat er besonders leichtes Spiel, da die Bäume durch die Trockenheit unter Stress leiden und weniger widerstandsfähig sind. Der Borkenkäfer hat in diesem Jahr drei Generationen produziert. Das heisst, von einem weiblichen Käfer im Frühjahr entstehen bis 1000 Käfer. Wenn das so weitergeht, wird die Fichte langsam, aber sicher aus dem Mittelland verschwinden und sich in höhere Lagen zurückziehen. Neben dem Werkhof wird gerade ein grosser Haufen Hackschnitzel in einen grossen Lastwagenanhänger geschüttet. «Das ist vom Borkenkäfer befallenes Holz, das wir zum Heizen verwerten, damit sich der Käfer nicht weiter ausbreitet» erklärt er.
Ein vielseitiger Wald ist ein schöner Wald
Die Fahrt führt wieder in den Wald hinein, an einer Kreuzung hält Rhyner an. «Dies hier ist der sogenannte Mittelwald», erklärt er. «Er wurde angelegt, um zu zeigen, wie die ursprüngliche Waldform der früheren Jahrhunderte einmal aussah. Man liess die grossen Bäume, Oberholz genannt, stehen, und nutzte sie als Bauholz. Die darunterliegende Schicht nennt sich Hauschicht und diente der Produktion von Brennholz». Anfang des 20. Jahrhunderts sank die Nachfrage nach Brennholz, und der Mittelwaldbetrieb wurde durch den heute noch praktizierten Hochwaldbetrieb abgelöst. Alle 20 bis 25 Jahre wird hier im Mittelwald die Hauschicht geschlagen und einzelne der ältesten, grossen Bäume geerntet.
Wann spricht eigentlich ein Förster von einem «schönen» Wald? «Für mich persönlich ist der überführte Mittelwald solch ein schöner Wald», sagt Rhyner. «Er ist vielseitig, es gibt Bäume allen Alters und viele verschiedene Laubholzarten». Der Nachwuchs für die kommenden 100 bis 150 Jahre sei gesichert, meint er. Man könnte meinen, wer in solchen langen Etappen plane, sehe nicht, was er erreicht habe. «Das stimmt so nicht», entgegnet Rhyner. «Für einen Laien mag es den Anschein haben, dass der Dauerwald immer gleichbleibt. Wenn man aber so viel Zeit darin verbringt, wie die Förster, sieht man, dass er sich in den vergangenen 20 Jahren stark verändert hat». So gäbe es im Gegensatz zu früher keine einförmigen, gleichaltrigen Baumbestände mehr. Die Artenvielfalt wurde auch auf kleinen Flächen erhöht und der Totholzanteil hat zugenommen. Der Wald weist praktisch auf der ganzen Fläche Nachwuchs auf, junge Bäume müssen nur noch in Ausnahmesituationen gepflanzt werden. Allgemein könne man sagen, dass die Wälder stabiler geworden seien und eine erhöhte Biodiversität aufwiesen.


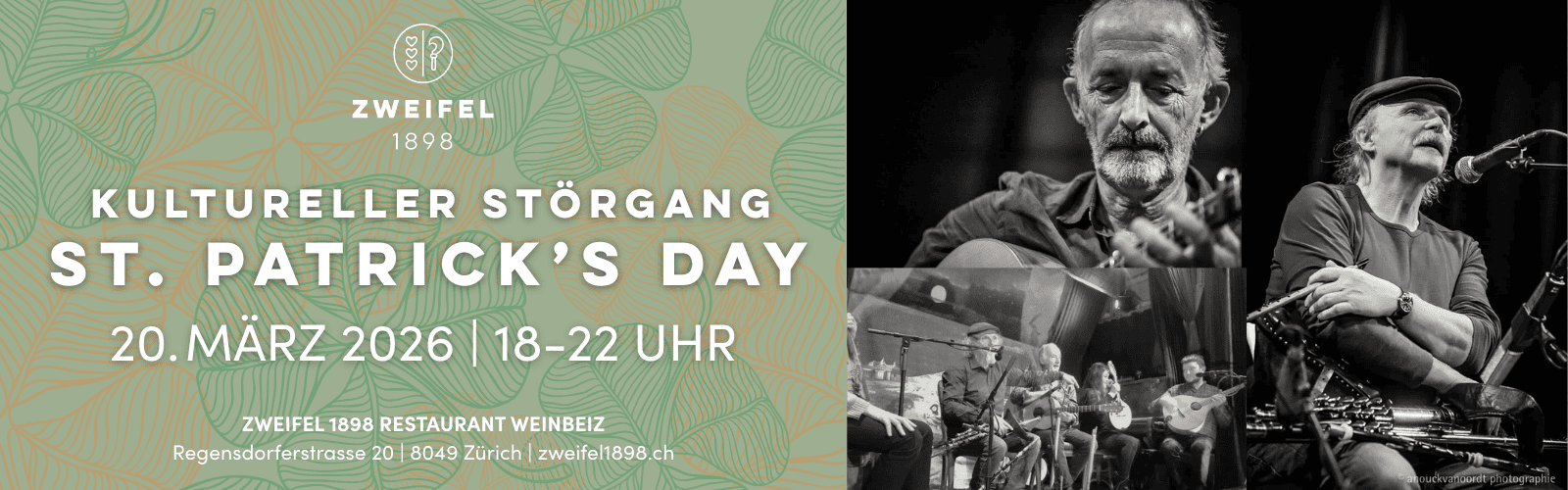


1 Kommentare
Maja Felder
30. April 2025 — 09:53 Uhr
Sehr geehrt Herr Förster,
Was passiert, wenn der Fuchs keine Scheu zeigt?
Im Areal GEWOBAG, Riedhofstrasse 352 – 374 Familien- und Alterswohnungen spaziert ein kleiner, hinkender ca. 2 Jahre alter Fuchs. Er kennt seit längeren Zeit keine Menschenscheue mehr. Wie können wir uns Verhalten? Er spaziert durch spielende Kleinkinder die begleitet sind von Erwachsenen , am hellen Tag am offenen Spielplatz mitten durchs GEWOBAG Grundstück über die Spiel-Wiese, geht zum Brunnen und trinkt daraus. Er lässt sich fast nicht wegweisen durch Rufe, Klatschen, Näher kommen! Mütter von Kinder und ich fühlen uns, unsicher und nicht sehr wohl dabei. Wie sollen Kinder dem Fuchs begegnen?
Zum Grundstück gehört auch ein Wäldchen, Grillplatz, wo die Kinder auch spielen können. Auch zum Revier des hinkenden Fuchses (und andere Füchse, die ich nur in der Nacht sehe) gehört auch der angrenzende Reebberg und Wäldchen und angrenzende Liegenschaften.
An der Reihnhold-Frei Strasse begegne ich dem kleinen, hinkenden Fuchs als ob er von der Bushaltestelle kommt mitten in anderen Menschen und ich kreuze ihn, weil ich auf den Bus ging. Ich bin irritiert und besorgt über sein Verhalten! Er hat seine natürliche Scheu durch den Menschen verloren und kennt keine SCHEU mehr vor ihnen!
Leider wird vom Hochhaus aus 378 von der untersten Wohnung aus, der oder die Füchse mit Servelats für ihr erscheinen belohnt.
Wie wird die Bevölkerung darauf hingewiesen, das füttern der Wildtiere, nicht gestattet ist? In der unserer Umgebung, Wald, Landwirtschaft, Stadt? Gibt es Fyler, Schilder, zu bekommen?
Seit fast 10 Jahren lebe ich jetzt in Höngg. Die Natur zu beobachten, Staunen zu können wieviele Wildtiere ich getroffen habe zu Hause und in Zürichs Umgebung ist für mich erstaunlich. Ich bin demütig, dankbar für ihre Arbeiten. Was werden sie tun?
Freundliche Grüsse
Maja Felder