Quartierleben
Die ETH im Dialog mit den Anwohnenden
Bereits zum zweiten Mal lud die ETH die Nachbarsquartiere Höngg und Affoltern zu einem Austausch über die geplante Campusentwicklung auf dem Hönggerberg ein.
3. Oktober 2025 — Dagmar Schräder
Der Campus der ETH auf dem Hönggerberg hat sich seit dem ersten Spatenstich im Jahr 1961 stark verändert. In mehreren Bauetappen wurde die Infrastruktur stetig ausgeweitet, seit 2015 folgt der Ausbau dem Masterplan «ETH Campus Hönggerberg 2040». Wie dieser konkret aussehen soll und welche Neuerungen in nächster Zeit geplant sind, darüber informierte die ETH am 23. September ihre Nachbarquartiere Höngg und Affoltern. Im «Dialoganlass» auf dem Hönggerberg erhielten zudem auch die beiden Quartiervereine die Gelegenheit, Wünsche und Bedürfnisse aus ihrer Sicht zu äussern.
So erklärte Pia Meier, die Präsidentin des Quartiervereins Affoltern, dass es in Affoltern durchaus mitunter gemischte Gefühle gegenüber der ETH gebe: Einerseits sei das Quartier stolz auf die renommierte Hochschule in unmittelbarer Umgebung und freue sich darüber, vielen Studierenden Wohnraum gewähren zu können. Andererseits sähen die Quartierbewohnenden das eine oder andere Bauvorhaben der ETH eher kritisch. Auch die im Masterplan 2040 enthaltenen Portal-Hochhäuser stiessen nicht nur auf Gegenliebe. Der Quartierverein arbeite aber sehr gerne mit der ETH zusammen und würde sich freuen, wenn er noch öfter in Diskussionen einbezogen würde.
Stolz auf die ETH sei auch das Quartier Höngg, betonte Alexander Jäger, der Präsident des hiesigen Quartiervereins. Der lebendige Campus erfreue die Menschen in Höngg. Als problematisch stufte er die Belegung des 80er-Busses zu Stosszeiten ein. Dieser sei einfach immer überfüllt. Man warte hier auf den Doppelgelenk-Trolleybus, den die VBZ mit der Elektrifizierung der Buslinie einzuführen gedenkt.
Der «Hönggerbergring»
Die Statements der Quartiervereine griff Hannes Pichler, der Direktor Immobilien der ETH, in seinen Erläuterungen auf. Die Beteiligung der Vereine und der Einbezug der Quartiere sei der ETH wichtig. Eine Dialogveranstaltung wie die aktuelle solle in Zukunft institutionalisiert werden, versprach er.

In der Folge ging er näher auf die aktuellen Bauvorhaben ein. Ziel des Masterplans 2040 mit den seit 2022 geltenden Sonderbauvorschriften sei eine nachhaltige Campusverdichtung. Die von Pia Meier bereits angedeuteten Portalbauten gehörten tatsächlich dazu, seien aber in den kommenden Jahren noch kein Thema. Aktuell ginge es insbesondere um die Innenentwicklung des Campus. Geplant sei in naher Zukunft insbesondere der Ausbau des «Hönggerbergrings», ein durchgehend begehbarer Ringweg rund um die ETH. Er ist weniger als Strasse, denn als Erholungsraum und Fussweg geplant, diene aber vorübergehend während der Bauarbeiten auch der besseren Zufahrt zu einzelnen Baustellen.
Lehrgebäude mit Bibliothek
Bei den Neubauten, die bereits im Bau oder in Planung sind, ging Pichler insbesondere auf die Gebäude mit den Kürzeln HPQ, HRZ und HWS ein. Beim HPQ-Gebäude handelt es sich um den neuen Physikbau mit den unterirdischen Labors, dessen Bezug für das Jahr 2030 geplat ist. Das HRZ-Gebäude wird das neue Rechenzentrum der ETH beinhalten, sozusagen das «Nervenzentrum» der Institution. Die Bauarbeiten hierzu begannen im Jahr 2023 und sollen im kommenden Jahr fertiggestellt werden (der «Höngger» berichtete über beide Projekte).
Der Bau des Gebäudes mit dem Kürzel HWS schliesslich stelle, so Pichler, einen essenziellen Teil des Masterplans dar. Hier soll ein neues Lehr- und Forschungszentrum entstehen. Dazu wird nicht nur die Bibliothek von der ETH im Zentrum auf den Hönggerberg umziehen, es wird im Gebäude auch ein Forum zur öffentlichen Nutzung entstehen, das Lehr- und Lernflächen, Shops und Restaurants beinhalten wird. Auch punkto Sanierungsarbeiten stehen einige Projekte an. So soll im kommenden Jahr die Wolfgang-Pauli-Strasse saniert werden, ab dem Jahr 2030 wird das HIL-Gebäude in Angriff genommen.
Ein weiterer nicht unerheblicher Teil der Innenverdichtung der ETH sei auch die Schaffung von Grün- und Freiflächen, die nicht nur dem Erhalt und der Erweiterung der Biodiversität dienen, sondern auch der Attraktivität und der Aufenthaltsqualität des Standorts. Denn die ETH, so erläuterte es Claudia Zingerli, die Leiterin von ETH Sustainability in der Podiumsrunde, diene nicht nur als Studien- und Forschungsstätte, sondern solle auch der Quartierbevölkerung als Erholungsort zur Verfügung stehen.
Gewinn fürs Quartier
Warum das gastronomische Angebot auf dem Campus für Quartierbewohnende teurer sei als für die Studierenden und Mitarbeitenden, wurde am Anlass moniert. Leicht kritisch hinterfragt wurde auch der Platzbedarf: Wie sei zu erklären, dass die Hochschule stetig wachse, während die Anzahl Jugendlicher in der Schweiz gleichzeitig sinke? Man müsse die Zahlen in einen grösseren Kontext stellen, wurde erklärt. Man verzeichne ein starkes Wachstum an Studierenden – einerseits, weil der Prozentsatz an Jugendlichen, die eine Hochschulausbildung anstrebten, grösser werde, andererseits aber auch, weil die ETH dank ihres guten Rufs einen Anziehungspunkt für Maturand*innen aus der ganzen Schweiz und, insbesondere im Masterstudium, auch in einem internationalen Rahmen darstelle.
Weiter wurde gefragt, ob jemals ein Ende der Veränderungen auf dem Campus zu erwarten sei. Ein Punkt, den Zingerli und Pichler schmunzelnd verneinten: Die Entwicklung gehe schliesslich immer weiter. Bei den abschliessenden Führungen und einem Apéro hatten die rund 50 Gäste dann die Gelegenheit, ihre Einblicke in diese Entwicklungen zu vertiefen.

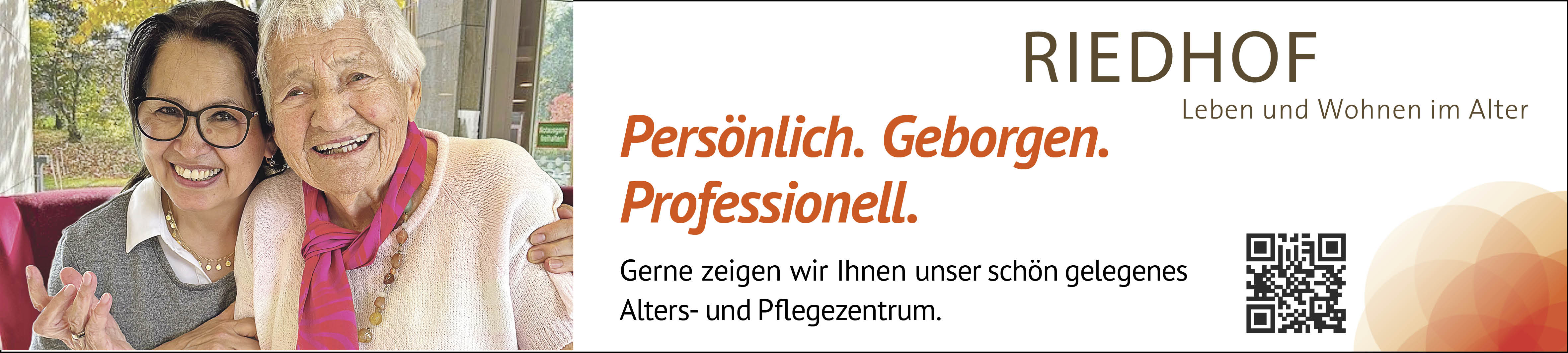



0 Kommentare