Quartierleben
Das «blaue Biest»
Mitte Januar wurde auf dem ETH Campus Hönggerberg die leistungsstärkste Zentrifuge Europas eingeweiht. In Betrieb ist sie allerdings schon länger: Bereits seit eineinhalb Jahren wird sie für geotechnische Forschung genutzt.
3. Februar 2025 — Dagmar Schräder
Genau 30 Jahre ist es her, seit ein Erdbeben in der japanischen Stadt Kobe für Tod und Zerstörung sorgte: Am 17. Januar 1995 erschütterte das Beben der Stufe 7 die Region, mehr als 6000 Menschen starben, 300 000 wurden obdachlos. Dieses Ereignis beschäftigte den ETH-Professor Ioannis Anastasopoulos nachhaltig.
Der geotechnische Ingenieur wollte sich verstärkt der Erforschung derartiger Naturphänomene und Katastrophen verschreiben und Erkenntnisse gewinnen, die eine bessere Vorbereitung auf Ereignisse wie dieses ermöglichen. Er hat sein Vorhaben in die Tat umgesetzt: 30 Jahre später konnte er am 17. Januar 2025 an der ETH Hönggerberg die Einweihung der leistungsstärksten Zentrifuge Europas feiern, mit deren Hilfe nicht nur generell die Standfestigkeit von Bauwirkungen erprobt, sondern auch Auswirkungen von Erdbeben, Tsunamis und anderen Erschütterungen auf Gebäude erforscht werden können.
Bescheidene 20 Tonnen
Dabei ist die Zentrifuge selber gar nicht neu, sondern bereits ziemlich in die Jahre gekommen: Sie wurde 1984 im Auftrag der Ruhr-Universität Bochum bestellt und in Duisburg bei der Firma Krupp produziert. Lange Jahre war sie im Ruhrgebiet im Einsatz, bis sie 2014 auseinandergebaut und in Lagerräumlichkeiten verstaut wurde. Mehr durch Zufall erfuhr Anastasopoulos von ihrer Existenz und stattete ihr 2016 einen ersten Besuch ab. Anschliessend leitete er die Übernahme des «blauen Biests», wie sie auch genannt wird, in die Wege.
Das war leichter gesagt als getan, weist das «Biest» doch eine Länge von neun Metern auf und wiegt bescheidene 20 Tonnen. Auf dem Hönggerberg musste dafür ein eigenes Gebäude erstellt werden. Entscheidend war dabei unter anderem sicherzustellen, dass das in unmittelbarer Nachbarschaft entstehende neue Physikgebäude durch die Zentrifugen-Starts nicht tangiert wird – denn die in diesem neuen Gebäude beheimatete Forschung reagiert äusserst empfindlich bereits auf kleinste Schwingungen und Vibrationen.
Auf kleinem Raum
Diese Vorarbeiten zur Installation der Zentrifuge nahmen einige Zeit in Anspruch: Im Herbst 2020 wurde der 250 Tonnen schwere Betonzylinder, in dem sich die Zentrifuge heute befindet, in den Neubau eingebaut, im Frühling 2021 schliesslich die Zentrifuge selbst aus Bochum angeliefert (der «Höngger» berichtete). Seit rund eineinhalb Jahren ist das Gerät nun in Betrieb und wird zu den verschiedensten Forschungszwecken genutzt, wie den Gästen der feierlichen Einweihung anschaulich dargelegt wurde: Hier werden Brückenpfeiler und Stützen von Offshore-Windanlagen auf ihre Stabilität getestet, Experimente zu den Folgen von Tsunamis gemacht und Gebäude möglichst standhaft konstruiert.
Die Zentrifuge hilft den Forschenden dabei, diese Auswirkungen auf vergleichsweise kleinem Raum zu simulieren. Denn die Beschleunigung, die das zu probende Material in der Zentrifuge erfährt, führt zu einer erhöhten Erdanziehung. Bis zu 250 G (Gravitationskonstante), also das 250-fache der Erdanziehung, kann die Zentrifuge maximal erreichen. Tatsächlich werden die Experimente an der ETH aber in der Grössenordnung um 100 G durchgeführt. Das bedeutet für die Objekte, dass sich ihr Gewicht ebenfalls um den Faktor hundert vergrössert. Ein Modell, das 100 Kilogramm wiegt, verhält sich in der Zentrifuge demnach so wie ein Objekt, das 10 Tonnen wiegt.
Damit können grosse Bauwerke nachgebaut werden und es kann untersucht werden, welche Kräfte diese auf den Boden ausüben beziehungsweise welchen Kräften sie selber ausgesetzt sind. Und mit dem eigens dafür erstellten Rütteltisch, der Erdbebenbewegungen nachstellt, können die Modelle zusätzlichen Erschütterungen ausgesetzt werden. Dadurch erhält man präzise Informationen, wie ein Gebäude auf Vibrationen reagiert.
Champagner im Schleudergang
Doch an diesem feierlichen Abend der Einweihung drehte sich (oder flog, wie die Fachleute sagen), die Zentrifuge zu einem ganz anderen Zweck: Die Forschenden hatten eine Champagnerflasche in ihrem Inneren installiert und beschleunigten diese nun auf das 20-fache der Erdanziehung. Mittels Kameras wurde das Experiment live zum Publikum im Hörsaal übertragen, welches das Schicksal der Flasche mit Spannung verfolgte: Es dauerte nicht lange, da wurde das Gewicht für das Glas zu gross – sie zersprang mit einem spektakulären Knall und Champagner ergoss sich über den Zentrifugen-Arm. Eine würdige Taufe für ein einzigartiges Forschungsinstrument.



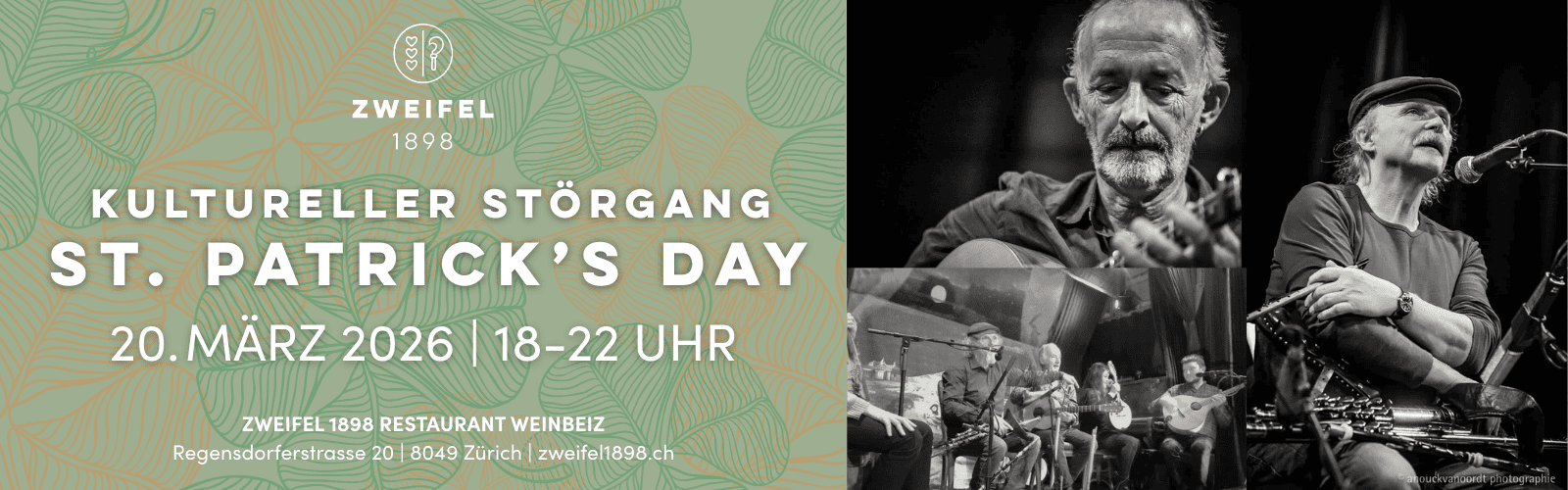
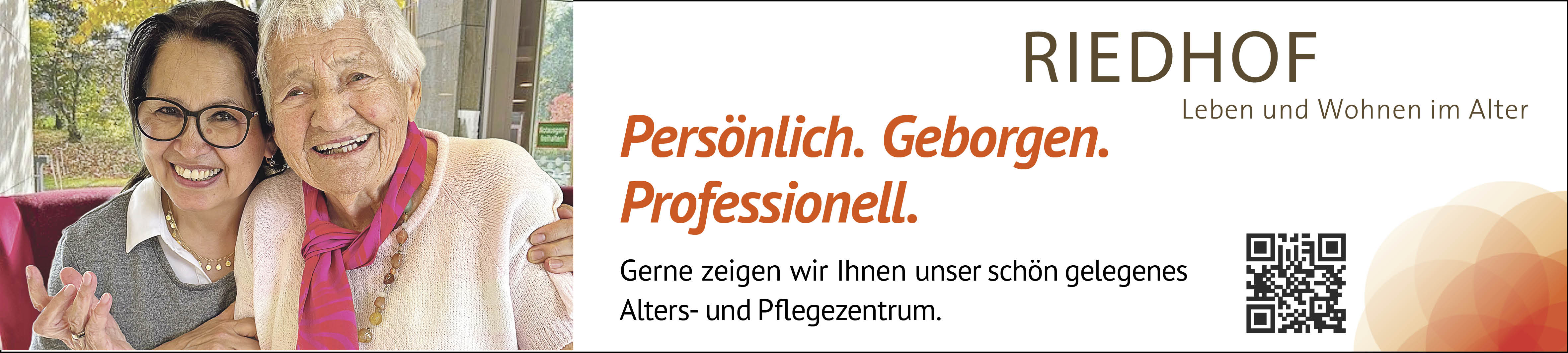
0 Kommentare