Höngger Fauna
Biene Maja im Konkurrenzkampf?
Um die Wildbienen besser zu unterstützen, will die Stadt Zürich künftig keine neuen Honigbienenstände auf Stadtgebiet mehr bewilligen. Nicht alle halten diese Massnahmen für angebracht.
12. November 2025 — Dagmar Schräder
Mitte September hat die Stadt Zürich bekannt gegeben, die Honigbienenhaltung auf städtischem Boden nicht mehr weiter zu fördern. Wer auf Stadtgebiet einen Honigbienenstand betreibt, darf diesen zwar auch in Zukunft noch weiterführen, solange der Pachtvertrag läuft. Doch wenn ein Vertrag ausläuft oder gekündigt wird, werden keine neuen Bienenstände mehr bewilligt. Grün Stadt Zürich empfiehlt daher, in Zukunft keine neuen Bienenstände auf städtischen Grundstücken zuzulassen. Bereits bestehende Bienenstände sollen in Gebieten, wo Wildbienen Vorrang haben, entfernt werden, wenn der Pachtvertrag beendet wird.
Begründet wird der Entschluss mit dem Ziel der Stadt, die «Vielfalt im Siedlungsraum zu fördern und dem Insektensterben entgegenzuwirken». Denn genau dieses Ziel sieht die Stadt Zürich durch die Honigbienen gefährdet – genauer gesagt: die Biodiversität der Wildbienen. Dabei beruft sie sich auf eine kürzlich veröffentlichte Studie der Eidgenössischen Forschungsanstalt für Wald, Schnee und Landschaft (WSL).
Nicht genug Nahrung für alle?
In der Schweiz leben rund 600 verschiedene Wildbienenarten, in Zürich sind rund 215 verschiedene Arten zu finden – über die Hälfte davon ist gefährdet. Wie ihre domestizierten Verwandten ernähren sich auch die Wildbienen von Pflanzennektar und sind als Bestäuberinnen für das Ökosystem von grosser Bedeutung. Anders als die Honigbienen leben sie jedoch meistens solitär und sind oft nur an wenigen Standorten und in sehr kleinen Populationen zu finden. Meistens sind die einzelnen Arten auf jeweils eine bestimmte Blütensorte spezialisiert.
Gleichzeitig ist in den vergangenen Jahren die Zahl der Honigbienen stetig gewachsen: Allein in der Stadt Zürich wurden im Jahr 2024 rund 200 Bienenstände registriert, schweizweit wurde zwischen 2012 und 2018 fast eine Verdoppelung der Stände gezählt. Dieses Ungleichgewicht könnte zu einer Nahrungskonkurrenz zwischen Honig- und Wildbienen führen, so die Studie der WSL. Deswegen sei eine Regulierung unumgänglich.
Ein Herz für Bienen – und Wildbienen
Wie aber sehen diejenigen die Situation, die hier direkt angesprochen werden – die Imkerinnen? Dazu gehören etwa Carlos und Ruth Guillen. Sie haben bereits vor über 30 Jahren im Rütihof einen Bienenstand übernommen, einige Jahre später konnten sie auch das dazugehörige Land erwerben. Ihr Freund Klaus Müller ist ebenfalls Imker, und zwar mitten in der Stadt, im Kreis 4. Direkt betroffen von der Entscheidung sind die drei zwar vorerst nicht – die Guillens können über ihren Bienenstock frei verfügen, weil er sich auf Privatgrund befindet, bei Müller würde sich allenfalls etwas ändern, wenn er sein Bienenhäuschen weitergeben würde.
Dennoch bedauern sie die Entscheidung der Stadt. «Die Äusserungen der Stadt haben bei uns schon für ein wenig Aufruhr gesorgt», erklären sie. Schliesslich lägen ihnen nicht nur die Zukunft der eigenen Bienenvölker, sondern auch die Biodiversität und die Wildbienen am Herzen. Nicht umsonst haben die Guillens deshalb bereits vor rund 20 Jahren vor ihrem Imkerhäuschen ein «Wildbienenhotel» aufgestellt. «Wir beobachten auf unserem Grundstück sicher sechs, sieben verschiedene Wildbienenarten», schwärmt Carlos Guillen.
Gut gemeint, aber nicht gut gemacht
Es sei zwar durchaus denkbar, dass die Honigbiene in bestimmten Situationen zur Konkurrenz für die Wildbiene werde, räumen alle ein. Schliesslich weise die Schweiz eine der höchsten Bienendichten der Welt auf. Dennoch seien die Massnahmen der Stadt in ihren Augen nicht wirklich nachhaltig. Denn erstens sei es gar nicht so einfach, die Entwicklung der Wildbienenpopulation zu untersuchen. Eine umfassende Studie über die Lebensräume und die Verteilung der Wildbienenpopulation auf Stadtgebiet fehle bisher. Die sei aber notwendig, um zu erkennen, wo Fördermassnahmen am meisten Sinn machten.
Darüber hinaus hätten sie sich primär andere Massnahmen gewünscht. So sei es immens wichtig, das Nahrungsangebot für Insekten zu erhöhen – etwa, indem noch mehr Flächen mit Wildblumen bepflanzt werden. Dafür gäbe es in der Stadt noch grosses Potenzial. «Neben der Nahrung sind es vor allem aber auch die fehlenden Brutgelegenheiten, die den Wildbienen Probleme bereiten», so Ruth Guillen. Insbesondere die bodennistenden Arten hätten in der Stadt einen schweren Stand. Versiegelte Böden und Steingärten seien nicht gerade förderlich.
Und in punkto Bestandsreduktion, so ein weiterer Gedanke, könnte die Stadt vielleicht auch dafür sorgen, dass auf städtischen Grundstücken nur Imkerinnen eine Bewilligung erhalten, die weniger als 20 Bienenvölker haben. «Für die Biodiversität wäre es zudem ein grosser Gewinn, wenn die städtischen Miet- und Pachtverträge sich auf die Haltung der ebenfalls vom Aussterben bedrohten einheimischen Honigbienenart beschränken würde.»
Lieber Kooperation als Konfrontation
Ein grösseres Problem als in der Stadt sehen die drei ohnehin auf dem Land. «In der Stadt herrscht eine künstliche Atmosphäre, hier ist es schwieriger, für den Erhalt von Wildtierarten aktiv zu werden. Auf dem Land aber, wo tatsächlich viel Potenzial wäre, werden kaum Massnahmen ergriffen», erklärt Müller. Man könne das Vorgehen der Stadt daher fast schon als Stellvertreterübung bezeichnen. Zu guter Letzt empfinden es die drei Bienenfreunde auch als verletzend, dass durch die Entscheidung und die Art der Kommunikation die Imker*innen zu einem «Feindbild» stilisiert worden seien. «Wir hätten es begrüsst, wenn die Stadt auf uns zugekommen wäre und versucht hätte, gemeinsam mit uns nach Lösungen zu suchen.»

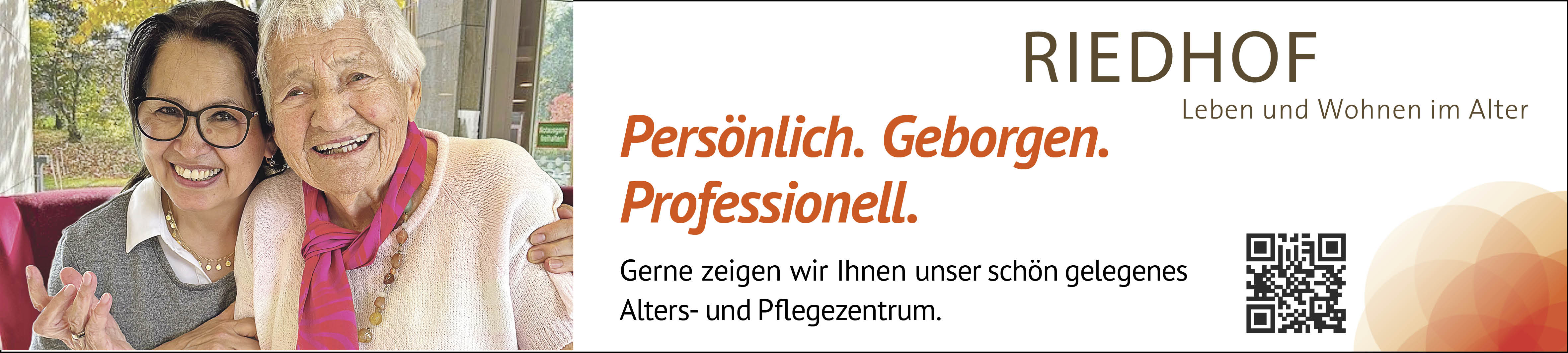

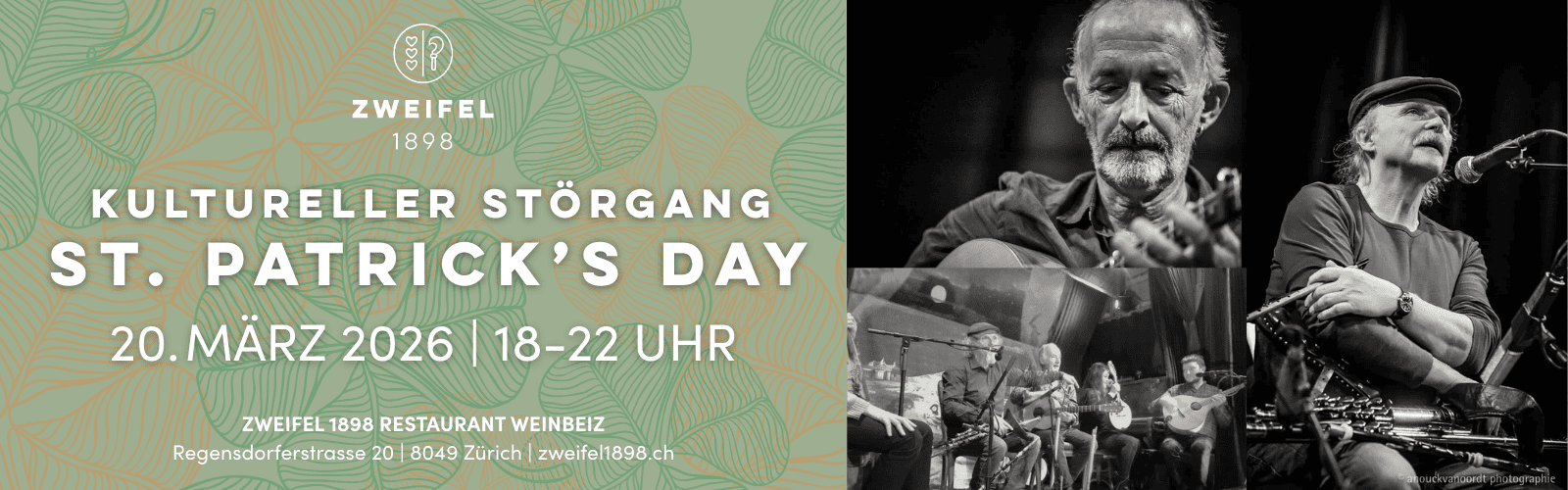

0 Kommentare