Quartierleben
Bäume für die Zukunft: unterwegs im Höngger Wald
Im kürzlich erschienenen Waldbericht 2025 gibt das Bundesamt für Umwelt einen Überblick über den Zustand der Schweizer Wälder. Grund genug, sich ein Bild vor Ort zu machen, wie es dem Höngger Wald geht. Forstingenieur Oliver Gerlach von Grün Stadt Zürich stand dem «Höngger» Rede und Antwort.
17. Mai 2025 — Dagmar Schräder
Nach 2005 und 2015 hat das Bundesamt für Umwelt dieses Jahr zum dritten Mal einen umfangreichen Bericht über die Schweizer Wälder veröffentlicht. Darin wird nicht nur ein Überblick über die aktuelle Lage gegeben, sondern auch ein Ausblick auf mögliche Antworten auf die Herausforderungen der Zukunft. Der Wald erfüllt eine Vielzahl von Funktionen. Er ist nicht nur Lebensraum zahlreicher Tier- und Pflanzenarten, sondern auch Erholungsraum für die Menschen, gewährt als Schutzwald Sicherheit vor Naturgewalten und dient zu guter Letzt auch als Holzlieferant.
Während die Bedeutung dieser Funktionen in den letzten Jahrzehnten stetig gestiegen ist, haben gerade auch im letzten Jahrzehnt die Herausforderungen für die Wälder stark zugenommen. Der Klimawandel macht dem Ökosystem zu schaffen, weswegen der Bericht den Zustand des Schweizer Waldes als «geschwächt» oder sogar als «kritisch» bezeichnet.
Tief im Wald wird geforscht
Doch wie ist die Situation in den Höngger Wäldern? Was sind die aktuellen Herausforderungen und wie wird ihnen begegnet? Forstingenieur Oliver Gerlach führt die Journalistin zur Beantwortung der Frage tief in den Höngger Wald hinein. Auf einer umzäunten Fläche wachsen verschiedene Bäumchen heran, daneben sind Testapparaturen aufgestellt. Hier werden im Rahmen eines Projekts der Eidgenössischen Forschungsanstalt für Wald, Schnee und Landschaft (WSL) seit 2023 Testpflanzungen vorgenommen. 56 solcher Pflanzungen finden sich über die ganze Schweiz verstreut.
Auf der Höngger Fläche sind acht Nadel- und Laubbaumarten gepflanzt, darunter Eichen, Fichten, Lärchen und Tannen, sowohl einheimische als auch ausserschweizerische Arten. Gleichzeitig werden Niederschlag und Temperatur gemessen und das Wachstum der Bäume in Bezug zum vorherrschenden Klima gesetzt. Das Experiment ist langfristig angelegt, die Projektdauer soll bis zum Jahr 2050 dauern.
Zukunftsbäume gesucht
Gesucht werden die idealen Bäume für die Zukunft. Denn viele der bestehenden Arten kommen mit den wärmeren Temperaturen und der zunehmenden Trockenheit nicht gut klar. Wie zum Beispiel die Fichte. Diese sei, so Gerlach, zu früheren Zeiten der «Brotbaum» der Schweizer Wälder gewesen. Bereits seit dem Mittelalter wurden systematisch Fichten gepflanzt, ihr Holz diente als wertvolles Bauholz. Rund ein Viertel der Bäume waren damals Fichten. Doch diese Zeiten sind vorbei: Mit ihren flachen Wurzeln wird die Fichte durch Hitze und Trockenheit schnell geschwächt. Und auch der Borkenkäfer stellt für sie ein Problem dar. «Heute machen die Fichten nur noch rund 5 Prozent der Bäume aus», erklärt Gerlach.
Mit Problemen kämpfen aber auch die Laubbäume – wie der hierzulande nach Buche und Ahorn dritthäufigste Laubbaum, die Esche. Rund 80 bis 90 Prozent der Eschen werden in absehbarer Zeit ausfallen. Ihr Problem ist vor allem das Eschentriebsterben, der Pilz, der die Bäume anfällig für weitere Erkrankungen macht und schliesslich dazu führt, dass die Wurzeln instabil werden. Eichen könnten dagegen in Zukunft von grösserer Bedeutung für die Wälder werden. Auch der Kastanienbaum, von dem auf Höngger Gebiet bereits einige Haine existieren, ist einer der Hoffnungsträger im Zusammenhang mit dem Klimawandel.
Nachhaltige Waldpflege im Fokus
Für die Pflege und Bewirtschaftung des Stadtwaldes ist Grün Stadt Zürich zuständig. Das Prinzip der Bewirtschaftung ist der sogenannte «Dauerwald». Dabei werde, so Gerlach, darauf geachtet, dass das Gesamtökosystem an allen Stellen bestehen bleibt. Beim Holzschlag würden keine flächigen Kahlschläge vorgenommen, sondern eher einzelne Baumindividuen entnommen. Es werde nicht nur Wert auf Artenvielfalt gelegt, sondern auch gewährleistet, dass unterschiedliche Generationen von Bäumen heranwachsen können.
Die jährlich auf Höngger Gebiet geerntete Holzmenge beträgt rund 1800 Kubikmeter Holz. «Das entspricht ziemlich genau der Menge, die pro Jahr hier nachwächst», erläutert Gerlach. Die Nutzung des geschlagenen Holzes folge dabei dem Prinzip der «Kaskadennutzung»: So viel wie möglich werde als Stammholz verwertet, rund ein Viertel bis einem Drittel davon könne zu Sägeholz verarbeitet werden. Sei dies aufgrund der Holzqualität nicht möglich, diene es als Industrieholz für Papier- und Zellstoffindustrie. Das qualitativ minderwertigste Holz schliesslich finde Verwendung als Energieholz.
Betrieb rund um die Uhr
Grundsätzlich aber, erklärt Gerlach, liege der Fokus der Forstbehörde vor allem auf der Pflege und nicht auf der Bewirtschaftung: «Die Verarbeitung des Holzes ist ein Nebenprodukt, das aus der Waldpflege entsteht. Unser Hauptprodukt ist vielmehr der Erhalt des Waldes als Lebensraum und als Naherholungsgebiet.» Eine Nutzung, die sich in den vergangenen Jahren deutlich intensiviert habe: «Wir haben mittlerweile einen 24-Stunden-Betrieb im Wald.» Ein Umstand, der zwar erfreulich sei, jedoch zuweilen auch gewisse Massnahmen erfordere: «Manche Nutzungen müssen ein wenig gelenkt werden, um dem Ökosystem keinen nachhaltigen Schaden zuzufügen», meint der Experte.
Klimawandel spürbar, aber weniger stark als andernorts
Generell, so zieht Gerlach ein kurzes Fazit, könne man sagen, dass der Höngger Wald zwar die Auswirkungen von Klimawandel und höherer Nutzung deutlich spüren, aber noch nicht ganz so dramatisch betroffen seien. Denn das Klima sei hier, das zeigten die Daten, stabiler als in anderen Gegenden. Auch die Böden seien in der Stadt eher tiefgründig und daher in der Lage, Wasser sehr gut zu speichern. Wichtig für die Zukunft sei die Förderung von arten- und generationenreichen Mischwäldern, weil diese nicht nur auf Trockenheit und Hitze, sondern auch auf die zunehmenden Extremereignisse wie Stürme sehr viel besser reagieren können als monokulturelle Wälder. Und natürlich ein verantwortungsvoller Umgang der Gesamtbevölkerung mit der wertvollen Ressource Wald.


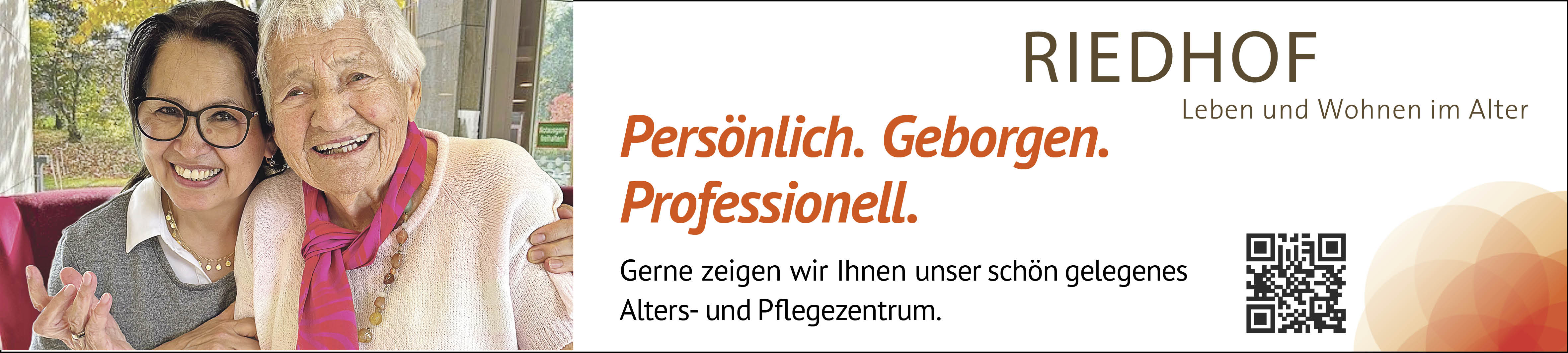
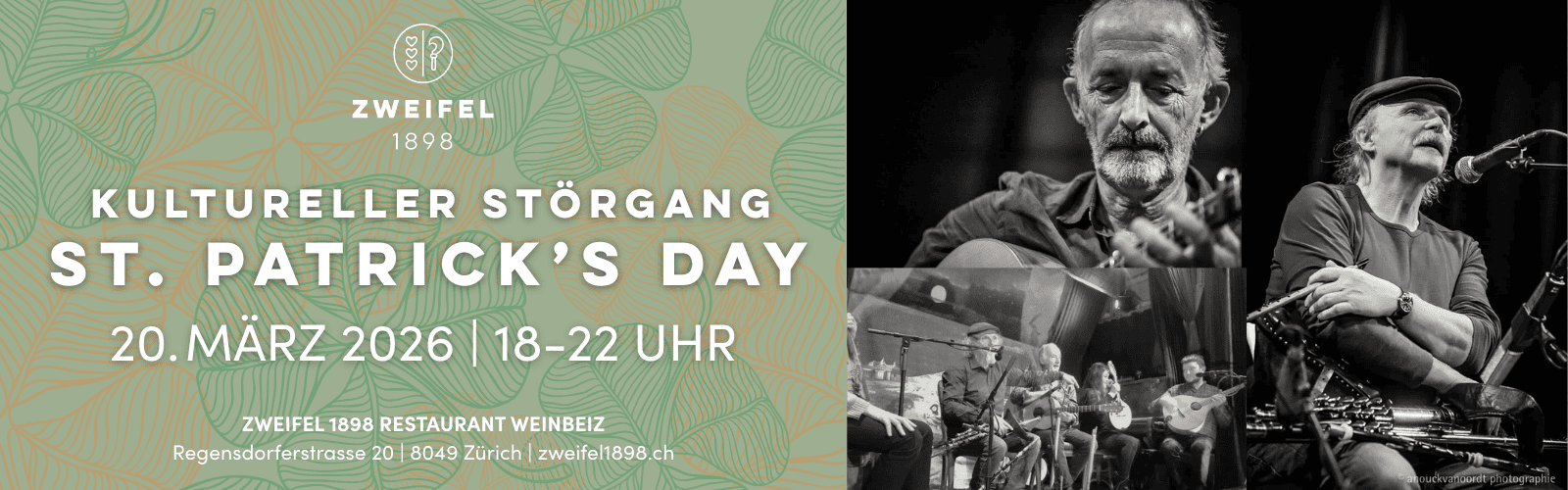

0 Kommentare