Kultur
Am Vorabend, als die Sonneschwarz wurde
Am Gründonnerstag luden der reformierte Kirchenchor Höngg und das Kammerorchester Aceras unter der Leitung von Peter Aregger zur «Musik und Wort»-Abendbesinnung mit «Die sieben letzten Worte von Jesu am Kreuz» von César Franck ein.
18. Mai 2025 — François Baer
Sich am Vorabend von Karfreitag und Ostern, am Gründonnerstag, zu einer Musik-und-Wort-Besinnung zu treffen, ist deshalb bemerkenswert, weil damit dem «Early Beginning» des dreitägigen Passionsgeschehens nachgespürt wird, das mit Verrat, Kreuzigung und Tod Jesu sowie dessen unglaublicher Auferstehung am Sonntagmorgen bis heute zum weltumstürzenden Datum geriet. Grün stammt nicht von den Frühlingsfarben, sondern vom althochdeutschen Greinen. Neben dem reformierten Kirchenchor und dem Orchester Aceras führten Sopranistin Catriona Bühler, Organistin Tamara Midelashvili Good und Pfarrer Max Schäfer mit seinen begleitenden Gedanken durch die Aufführung.
Dass die «Sieben Worte Jesu am Kreuz» auch eine eigene Auferstehungsgeschichte haben, ist verblüffend und einigermassen unerklärlich, denn die, nach César Francks eigenhändiger Datierung am 14. August 1859, also während seiner Amtszeit an Ste-Clotilde in Paris abgeschlossene, Komposition hat nach heutiger Kenntnis zu Lebzeiten ihres Schöpfers nie eine Aufführung erlebt. Entdeckt wurde sie 1955, als die Lütticher Bibliothek das Autograph aus Privatbesitz kaufte, aber erst 118 Jahre nach der Entstehung, am 6. März 1977, wurde es in Geislingen, Deutschland, uraufgeführt.
Eine Vertiefung des Geschehens
Franck ging es nicht um eine dramatische Darstellung der Leidensgeschichte Christi, vielmehr suchte er nach einer Vertiefung des Geschehens von Golgatha anhand der letzten Äusserungen Jesu am Kreuz: Vergebung, Heilszusage, Mitleiden, Verlassenheit, Not, Erlösung und Gottergebenheit. Und weil die Aussprüche Jesu wirklich kurz sind, verband er diese mit auslegenden Texten der Bibel und der Liturgie und schuf dabei eine breitere Grundlage für die musikalische Ausführung und setzte deshalb auch einen musikalischen Prolog: «O omnes, qui transitis per viam»; «Oh alle, die ihr des Weges kommt» sowie «attendite et videte, si est dolor meus (…)»; «merket auf und schauet, ob je ein Schmerz wohl meines Schmerze gleichet. Er hat mich, oh Herr, einsam gemacht und voll Trauer, den ganzen Tag» (Klagelieder, Jeremia 1,12).
Der neue Höngger Pfarrer
Und eh wir es begreifen, erklingt eine hohe, klare Frauenstimme von der Empore her, dort wo auch der Chor und die Orgel stehen, steigt weiter auf, ein einzelnes Cello stimmt ein und die Orgel begleitet sanft diese Tongirlanden. An deren Schluss steht vorne Pfarrer Max Schäfer, der neue Höngger Pfarrer, der erst die Mitwirkenden begrüsst und dann in seinen Wort-Part mit Gedanken, Gebeten und Briefen von Dietrich Bonhoeffer (4. Februar 1906 bis 9. April 1945) einführt.
Pfarrer Schäfers Wahl hatte mehrere Bezüge zu Jesus letzten Stunden und Bonhoeffers Einkerkerung im KZ Flossenbürg sowie zu seiner – auf ausdrücklichen Befehl Adolf Hitlers angeordneten – Hinrichtung vor ziemlich genau achtzig Jahren, rund einen Monat vor Kriegsende. Als Theologe hatte er früh schon als Vertreter der Oppositionsbewegung «Bekennende Kirche» öffentlich Stellung gegen die nationalsozialistische Judenverfolgung bezogen. In seinen Gefängnisbriefen hatte er sich weiter mit der künftigen, solidarischeren Ausrichtung der Kirche mit den Bedürftigen und zu einer nicht religiösen Interpretation von Bibel, kirchlicher Tradition und Gottesdienst auseinandergesetzt.
«Von guten Mächten»
Die beiden ersten Worte – «Vater vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun» und «Wahrlich, ich sage dir: Heute wirst du mit mir im Paradies sein» – leben erst von einem Dialog zwischen Cello und Chor, zwischen Hell und Dunkel. Später ergänzt der Chor mit Hiobs Spruch «Meine Freunde haben sich zurückgezogen, und die mich kannten, haben mich vergessen», aber nicht verhalten und karg, sondern melodisch und stützt damit die Sopranistin in der dramatischen Steigerung ihres Ausdrucks, dass gerade dieses Zweifeln Jesu zeigt, dass auch wir mit Gott hadern, ja streiten dürfen.
Bevor Chor, Cello und die Orgelbegleitung mit ihren «falschen» Trompetenstimmen Catriona Bühler mit ihrer eleganten, reinen und kraftvollen Stimme zum Höhepunkt und Schluss des Werks führten, schilderte Pfarrer Schäfer Dietrich Bonhoeffers letztes Zeugnis vor seinem Tod: Das Gebet «Von guten Mächten», das er in seinem Weihnachtsbrief aus dem Gestapokeller an seine Verlobte schicken konnte, das mittlerweile vielfach vertont wurde und zu einem der bekanntesten modernen Kirchenlieder geworden ist.
Und dann: Consummatum est – Es ist vollbracht! Mit heller Stimme meldet dies der Chor, das Cello kommentiert dies tieftraurig und die Orgel bestätigt es: So ist es. Der Tempelvorhang ist zerrissen, die Sonne schwarz geworden. Aber dennoch gibt es ein allerletztes Wort Christi: «Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist», «Pater, in manus tuas commendo spiritum meum».


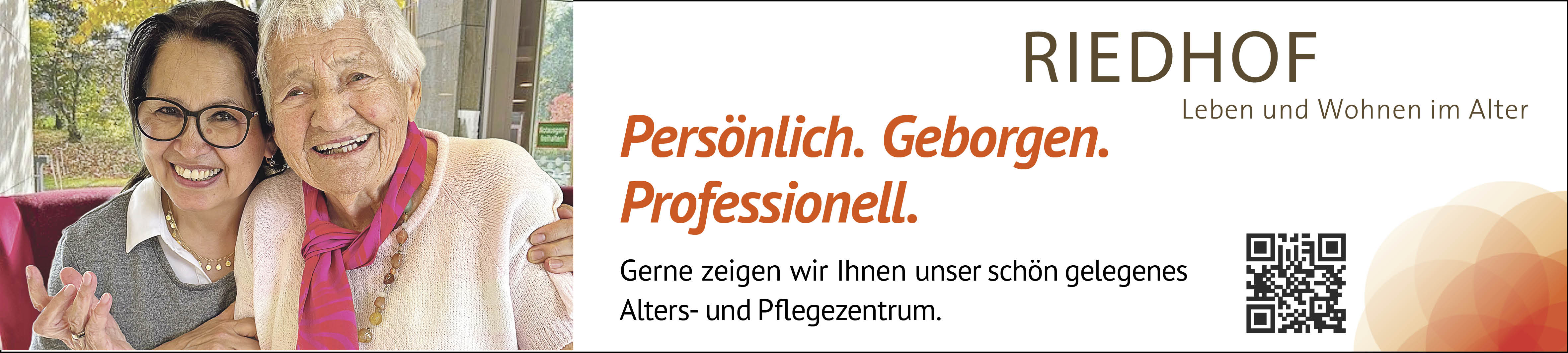
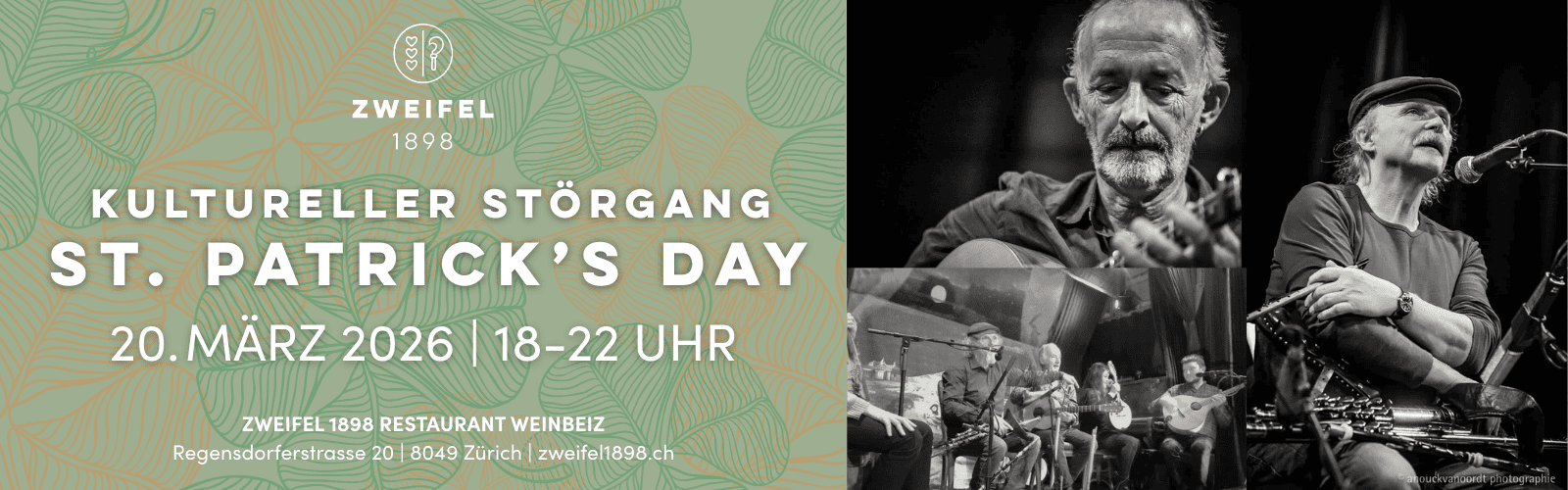

0 Kommentare