Quartierleben
Als der «Teufel» zwei Höngger heimsuchte
Es ist eine üble Geschichte für starke Nerven: Vor 450 Jahren ereignet sich eine rätselhafte Begebenheit in Höngg – beschrieben in der «Wickiana». Ein Gastbeitrag von Max Fuhrer.
15. Oktober 2025 — Eingesandter Artikel
«Was Foelixen Buri, und Simon Nözli, von Höngg, vom bösen fyend, dem tüfel widerfaren und begegnet, ein warhaffte historia»
Wann geschah das schreckliche Ereignis?
Es ist Montag, 12. September 1575. Der Morgen graut. Zwei Höngger, Felix Buri und Simon Nözli, kehren von der Zürcher Kirchweih und der Nachchilbi am Felix-und-Regula-Tag, dem 11. September, beschwingt – oder mehr beduselt und nichts Böses ahnend – heim in das Rebbauerndorf. Diese exakte Datierung der Geschichte, mit einer kolorierten Federzeichnung illustriert, suggeriert Authentizität und deutet auf ein damals tatsächlich eingetretenes Ereignis hin.
Was hat sich an diesem frühen Morgen ereignet?
Die beiden Protagonisten streifen auf gesperrten Flur- beziehungsweise Kammerwegen durch die ausgedehnten Höngger Rebberge, obwohl dies ab Spätsommer in der Traubenreife streng verboten ist. Sie überwinden die mit Dornen versperrten Zugänge. Wollten sie sogar noch Trauben stehlen? Plötzlich wird Felix Buri von einem merkwürdigen, undefinierbaren Wesen angegriffen, das ihn trotz Gegenwehr nach kurzem Kampf wuchtig über Reben und Dornenhecken auf die Landstrasse schleudert (Originalzitate):
… ein kleines manli, in einem grawen röckli, und ein rot käppli uffgehan, dem Foelix Buri an sinem rok gehanget, … hilff Simon, hilff mir, … will mir minen rock abzühen … und in über den grünhag, in die landstrass geworffen …
Der hilfreich beistehende Simon Nözli entgeht dem dreisten Überfall ebenfalls nicht und wird ähnlich drangsaliert:
… Jnndem hatt der böss geÿst den Simon Nözli auch erwüscht, und in über den grünhag, über die landstrass hinuss,… in die räben geworffen …
Und als letzter Akt dieses Dramas: Ein höllischer Gestank umnebelt sie, verstärkt von einem heftigen Donner:
… hatt er einen söllichen luthen furz gelassen, der ein söllichen wüsten stank von im gäben, den sÿ (Buri/Nözli) derglÿchen nie gschmekt …
Wie stellt das Bild das unglaubliche Ereignis dar?
Die kolorierte Federzeichnung vereinigt zwei Szenen: Buri und Nözli begeben sich auf verbotenen Flurwegen in den Reben Richtung Höngg (rechts). Ab Bildmitte wird der dreiste Überfall mit dem ominösen «Manli» dargestellt. Im Hintergrund befindet sich ein neues markantes, gelbliches Gebäude. Wozu?
Das Bild verrät zudem einen historisch interessanten Aspekt des damaligen Höngger Rebwesens. Es stellt neun sogenannte «Gehelde» dar (Pergola ähnliche Gebilde, wie auch in der Murer/Froschauer-Planvedute der Stadt Zürich, 1576). Meist umfassen sie zehn Rebstöcke.
Wo befindet sich der Tatort?
Die genaue örtliche Beschreibung erhöht die Glaubwürdigkeit der Geschichte: «sy nütt wyt zu herren obman Aeschers säligen (Escher selig) trotten kommen». Der Vorfall ereignet sich also in der Nähe einer Trotte unmittelbar nach Betreten des Höngger Gebiets. Dort befindet sich die neue zweigeschossige, gelbliche Scheune – ein «Trotthaus» mit einer eichernen Stud (Trotte) im Innern. Die Jahreszahl 1574 verrät das Baujahr.
Die Identität der Protagonisten?
Die Namen der beiden alteingesessenen Höngger Familien Buri und Nözli sind urkundlich belegt: Ein Simon Nözli wird im Rechtsstreit vom 19. Januar 1572 erwähnt, ein Felix Buri ist 1601 als Vater im Höngger Taufbuch von 1599 nachgewiesen – generationenmässig vermutlich ein direkter Nachkomme.
Wer oder was ist wohl dieses geschilderte «Manli»?
Die beiden Heimkehrer in ihrem physischen Zustand – torkelnd, schwankend, stolpernd – nehmen ihre Umgebung kaum mehr richtig wahr. So könnten sie bewegende Sträucher im Wind oder im Schatten als unterschiedliche Silhouetten interpretieren, die Sinnestäuschungen und optische Irritationen bewirken. In einer gefährlichen Zeit mit vielen noch unheimlicheren und
unerklärbaren Phänomenen! Oder haben sie einen überraschenden
direkten Kontakt mit einem lebendigen Wesen wirklich erlebt?
Wer hat die Geschichte überliefert?
Der protestantische Geistliche Johann Jakob Wick (1522 bis 1588) schildert den Ablauf dieses Ereignisses, jedoch nicht als Augenzeuge. Die Nachricht ist ihm wohl kurz danach zugetragen worden. Wick präsentiert die Geschichte ausführlich in seiner Sammlung von Kuriositäten und Begebenheiten, betitelt mit «Erschröckliche und warhafftige Wunderzeichen 1543–1586». Die Sammlung nennt er selbst «Wunderbücher». Sie umfasst 24 Foliobände und enthält von Wick selbst verfasste Texte und Zeichnungen sowie Berichte aus aller Welt. Später wird das Konvolut als «Wickiana» bezeichnet. Der Zürcher studierte Theologie an mehreren Universitäten, versah verschiedene Pfarrämter und war von 1557 bis zu seinem Tod zweiter Archidiakon und Chorherr am Zürcher Grossmünster.
Wie glaubwürdig ist dieser Bericht aus der Sicht von Zeitgenossen des 21. Jahrhunderts?
Heutige Leser und Leserinnen glauben wohl kaum an die Existenz von gespenstischen Figuren mit übermenschlichen Kräften wie dem «Manli», das mit dem «höllischen Gestank» und dem «söllichen luten furz» stark an den Teufel erinnert. Rational und aufgeklärt ist man versucht, den Vorfall vernünftig zu erklären. Verursachte also der starke Alkoholgenuss und die Müdigkeit bei Buri und Nözli Halluzinationen? Hielten sie eine Vogelscheuche für das «manli»? War es ein kräftiger, versteckter Flurwächter, der den «Mundraub», den Diebstahl von Trauben, verhindern wollte?
Dass ein ausgewachsener «Affe» dabei mitgewirkt haben könnte – wie eine neuere seriöse Quelle vermutet –, kann wohl ausgeschlossen werden. Gab es damals schon «Böller», die Donner und Gestank verursachen konnten? Ist das geschilderte «Hinüberwerfen» eventuell eine Schreckreaktion, in dem sie sich mit Sprüngen über den Dörnhaag «retten»? Suchten Nözli und Buri einfach eine Erklärung für ihre Verletzungen, die sie sich möglicherweise beim nächtlichen Traubendiebstahl zugezogen haben?
Aus der Sicht von Zeitgenossen des 16. Jahrhunderts:
Im Jahr 1575 hätte man sich diese Fragen kaum gestellt. Man glaubte an die Wirksamkeit des Teufels, an die verhängnisvollen Tätigkeiten der Hexen, an die Existenz von Gespenstern und Dämonen. Von all diesen wimmelt es in der «Wickiana». Und Berichte wie jener aus Höngg bestätigten die Richtigkeit des damaligen Weltbildes.
«Se non è vero, è ben trovato.»
Ein Artikel von Max Furrer
Quellen
Dieser Text basiert auf der buchstaben- und zeilengetreuen Transkription des handschriftlichen Eintrags in der «Wickiana».
Quellen:
Huch, Ricarda: «Die Wicksche Sammlung von Flugblättern und Zeitungsnachrichten aus dem 16. Jahrhundert …».
In: Neujahrsblatt auf das Jahr 1895, hrsg. von der Stadtbibliothek Zürich, 1894.
Wickiana (ZBZ Ms F 24, S. 322)
Sibler, Georg: Ortsgeschichte Höngg. Zürich, 1998, S. 115, 420 (Buri), 424 (Nözli)
OGK Höngg Mitteilung 17, S. 6 (1956)
NZZ 2022-05-30/S. 13


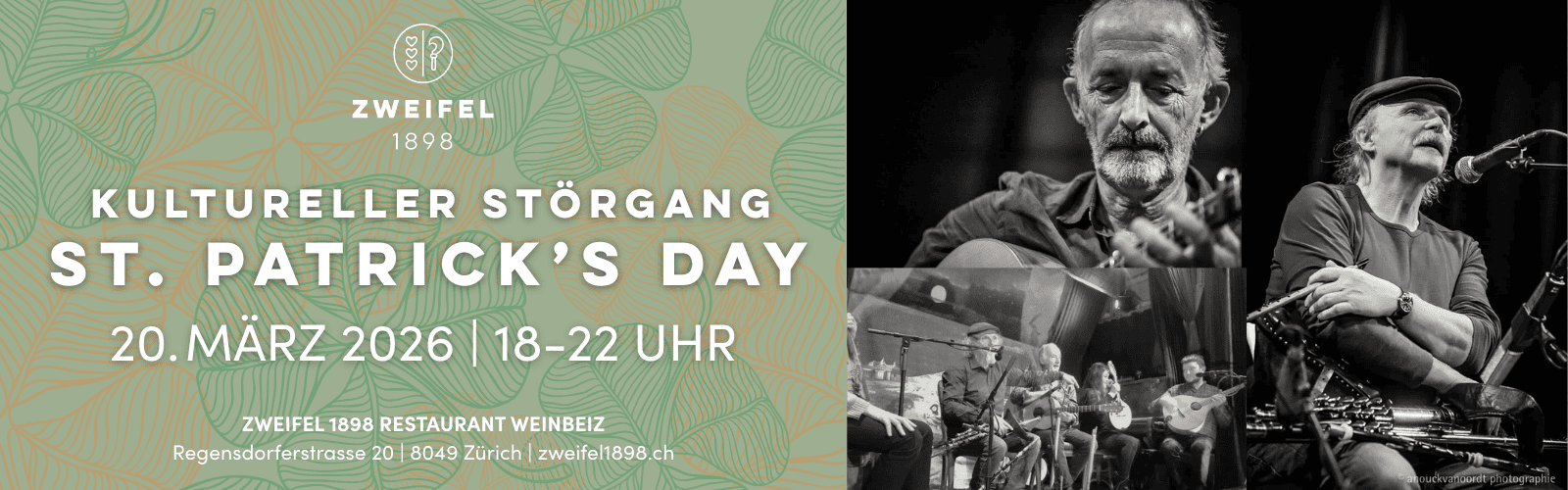
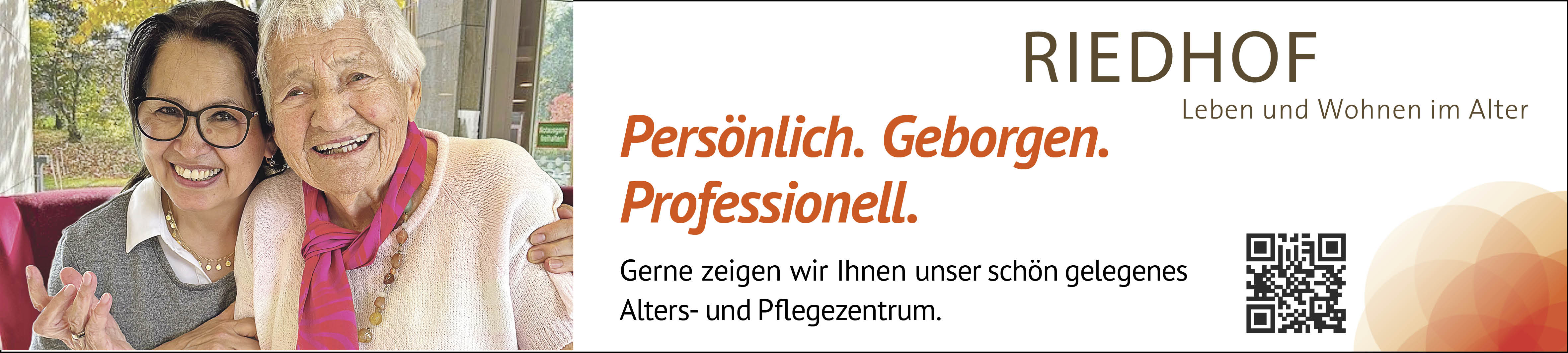

0 Kommentare