Quartierleben
6 x 75 Jahre in Höngg – Teil 4
Im dritten Teil erzählten die sechs Hönggerinnen von Erlebnissen in Höngg zur Zeit des Zweiten Weltkriegs, über Landpreise und wie man sich als Selbstversorger zu helfen wusste. Auch der vierte Teil der Serie beschäftigt sich weitgehend mit dieser Zeit.
27. Mai 2010 — Fredy Haffner
Für den «Höngger» überraschend wollte sich niemand am Tisch gerne an Schokolade erinnern. Ja, es habe welche gegeben, zum Beispiel mit Dörrfeigen, aber nichts Gutes. «Pilsbrause!», tönte es da plötzlich und jemand ergänzt sofort, die habe es aber nur an der «Chilbi» gegeben. Womit das Stichwort kurz von den Kriegszeiten ablenkte. «Die Chilbi! Auf dem Pausenplatz des ‹Bläsis›, immer am ersten Wochenende der Ferien . . . » «Also ich erinnere mich an meine allererste Chilbi», meldete sich Leonie von Aesch-Weinmann, «die war am Zwielplatz unten, vor der «Mülihalde». Einmal pro Jahr, man nannte es Varieté. Mich beeindruckte vor allem der Hochseiltänzer. Die ‹Rössliriiti› kostete 20 Rappen und jeden, den man kannte, bettelte man um eine Chilbirunde an.» «Also mich», ergänzte Margrit Furrer-Hartmann, «hat vor allem die Frau beschäftigt, die sie da in einen Kasten legten und zersägten.» Und so zogen die Erinnerungen durch die vergnüglichen Seiten im Höngg jener Zeit. Und zu den Restaurants, betrachtet durch Kinderaugen: «Die ‹Alte Post›, an der Limmattalstrasse 227; Jucker (siehe Kasten) hiess der Wirt, der hatte im ersten Stock eine Modelleisenbahn, die er im Winter oder an Regensonntagen gratis laufen liess und wir durften zusehen. Das waren die schönsten Sonntagnachmittage.» – «Ja, der Jucker», wirft Margrit ein, «der hatte doch so einen dicken Bauch, dass sie an seinem Platz am Tisch extra ein Stück raussägen mussten, damit er nahe genug am Teller sass. Das erzählte man sich damals in der Damenriege, und den Tisch habe ich sogar mal gesehen – wie der Jucker aussah, weiss ich nicht mehr, aber den Tisch sehe ich noch deutlich vor mir.»
Erinnerungen an den Bombenabwurf in Höngg
Und mit Bildern, die sich im Gedächtnis festgeprägt haben, landete das Gespräch auch wieder bei den weniger amüsanten Erinnerungen an die Kriegsjahre: «Ich sehe das Bild einer Badewanne, die so schräg im Nichts hängt und man glaubt, sie falle jeden Augenblick aus den Überresten jenes am 22. Dezember 1940 bombardierten Hauses an der Limmattalstrasse 23. Selbst heute, wenn ich mit dem Tram dort vorbeifahre, sehe ich das noch vor mir», erzählte Leonie und rief damit bei allen Erinnerungen ab. Eindrücklich sei das gewesen, am Tag danach die noch rauchende Ruine zu besichtigen, in denen ein Mensch ums Leben kam und vier verletzt wurden. (Anmerkung der Redaktion: Der «Höngger» vom 27. Dezember 1940 schrieb dazu: «Die erste Fliegerbombe, die je auf Zürich abgeworfen wurde, musste ein Haus unseres friedlichen Quartiers treffen. (. . .) Weitere Liegenschaften an der Ackersteinstrasse wurden durch Brandbomben beschädigt. (. . .) Auch wenn wir Kriegslieferungen an die Achsenmächte ausführen würden, so rechtfertigt das keine Neutralitätsverletzung, da wir auf den Export angewiesen sind und jeden Besteller beliefern müssen, um unsere Industrie und damit vielen Arbeitern die Beschäftigung zu erhalten. Der 22. Dezember 1940 bleibt ein schwarzer Tag in der Lokalgeschichte von Höngg.»
Die Abwürfe galten den Industrien von Escher-Wyss und Oerlikon Bührle, die Schweiz machte England für die Abwürfe verantwortlich, konnte die Beweise dafür aber offenbar nicht schlüssig erbringen. Wurde der Krieg durch dieses Ereignis fassbarer oder gar bedrohlicher? «Ausserhalb des Elternhauses fand ich es eine bedrohliche Situation», erwiderte Ursula, die sich auch noch an die Bombardierung des Bahnviaduktes in derselben Nacht erinnerte. Aber auch zu Hause habe man Angst gehabt. Vor allem nachts. Viele krochen zu ihren Eltern ins Bett, wenn der Fliegeralarm losging und die Bomber über Zürich flogen, bis einzelne dann und wann von Suchscheinwerfern erfasst wurden und man versuchte, sie in Dübendorf zur Landung zu zwingen. «Was?! Ihr verbrachtet die Nacht nicht im Luftschutzkeller?», wurde da mit einem ironischen Unterton eingeworfen. «Was heisst da schon ‹Luftschutzkeller›? Man musste einfach einen Teil des normalen Kellers als Luftschutzraum herrichten und aussen am Raum war dann ein grosses gelbes ‹L› aufgemalt», berichtete Ursula Volkart-Lahme und Marie-Antoinette Lauer-Moos verwies darauf, dass in ihrem Haus dieses ‹L› noch heute zu sehen sei. Allgemein wurde aber die Meinung vertreten, dass diese Keller oft gar nichts genutzt hätten und dass man nur zu Beginn des Krieges hinuntergegangen sei, später nicht mehr. In der Schule dagegen wurde dies etwas strikter gehandhabt, wie sich Erika Ringger-Mayer erinnerte: «Wenn der Alarm losging, mussten im Bläsi alle in den Luftschutzkeller. Ich fand das unheimlich spannend, wie da alle, Gross und Klein, die Treppen hinunter rannten. Unten war dann ein grosses Geschnatter, Margrit und ich hatten es immer lustig und freuten uns deshalb beinahe, wenn Alarm war.»
Bei Fliegeralarm: Auf dem Dach zum Beobachten
Andere, nicht in dieser Runde gehörte Geschichten erzählten jedoch davon, wie die älteren Burschen, die bei Sekundarlehrer Eugen Böckli in der Klasse waren, bei einem Alarm nicht in den Keller, sondern im Gegenteil aufs Dach stiegen, um die Flugzeuge zu beobachten und ihren Lehrer beinahe zur Verzweiflung brachten. Doch noch etwas machte Ursula im Zusammenhang mit den Alarmen Eindruck: «Die Unterstufe besuchten wir bei Walter Hintermann im Schulhaus Wettingertobel, dort wo heute Hort und Kindergarten sind. Da gab es noch kein Telefon. Der Alarm erreichte zuerst das Pfarrhaus nebenan und von dort kam dann die Frau von Pfarrer Trautvetter und rief, dass wir in den Luftschutzkeller müssten. Das war dann das Feuerwehrdepot gleich nebenan, mit den alten, mit Blachen abgedeckten, riesigen Feuerwehrfahrzeugen – ich hatte zwischen diesen Ungetümen immer Angst, das war fast unheimlicher als der Fliegeralarm selbst.» Was und wie aber bekamen die Kinder damals vom Krieg sonst noch mit, ausser der Rationierung und den Fliegeralarmen? «Als mein Vater ins Militär musste», erzählte Margrit, «da weinte meine Mutter und ich dachte: ‹Oh, das ist jetzt wohl ganz schlimm›.» Ja, da hatte man dann schon Angst um den Vater. Und Luftschutzkurse für nicht Wehrdienstpflichtige zur Bekämpfung von Bränden waren obligatorisch, Erika erhielt sogar eine Gasmaske in Kindergrösse und Bethli erinnerte sich an Sandsäcke und Handfeuerwehrspritzen auf dem Estrich. Von Hitler hatten auch die Kinder gehört, wenn auch nur mit einem Ohr. Die Lehrer hätten sich vor diesem Thema gedrückt, doch zuhause am Tisch oder über Radio, Zeitung und Illustrierte habe man etwas mitbekommen. Ein Onkel von Ursula lebte in Mailand und sie wusste noch, wie all seine Briefe zensuriert ankamen, mit schwarzen Balken überall – wahrscheinlich, so vermutete sie, sei dies umgekehrt auch so gewesen.
«Zur Person»
Karl Jucker, 1888 bis 1960: Das Haus in dem das Restaurant Alte Post war, wurde 1961 abgebrochen, als die Limmattalstrasse verbreitert wurde.




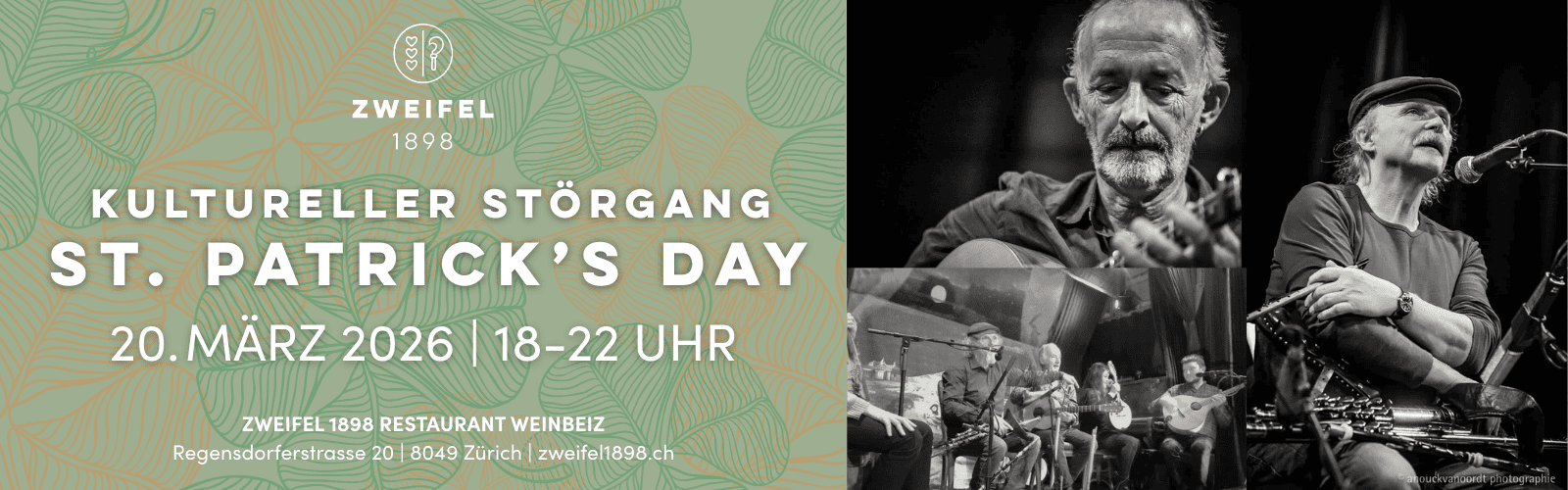
1 Kommentare