Wir sind Höngg
Sich vom Schicksal nicht beirren lassen
Obwohl sie zahlreiche Schicksalsschläge einstecken musste, bleibt Cornelia Zumsteg optimistisch. Sie glaubt fest daran, dass immer irgendwo ein Türchen aufgeht, wenn sich eines schliesst und geht aktiv und selbstbestimmt durchs Leben.
2. Oktober 2020 — Dagmar Schräder
Bis zum Alter von drei Jahren hatte ich eine unbeschwerte Kindheit – das ganz normale, alltägliche Glück: Ich war aktiv, rannte, lachte, spielte. Doch dann – über Nacht – änderte sich mein Leben komplett. Ich ging abends gesund ins Bett und wachte am nächsten Tag schwerkrank auf, von den Füssen bis zum Kiefer gelähmt. Ein traumatisches Erlebnis nicht nur für mich, sondern auch für meine Eltern und meinen Bruder. Im Krankenhaus diagnostizierten die Ärzte «Knochentuberkulose» und begannen mich zu behandeln. Ein fataler Fehler. Denn in Wirklichkeit hatte ich nicht Tuberkulose, sondern litt an juveniler Polyarthritis, einer chronischen Gelenksentzündung.
In den nächsten Jahren kannte ich eigentlich nur noch Schmerzen, Arztbesuche und Krankenhäuser. Schon die kleinsten Berührungen verursachten starke Schmerzen – ich konnte nachts nicht mal mit Bettdecke schlafen, so unerträglich war der Druck, den sie verursachte. Stattdessen bastelten meine Eltern mir eine Art Tunnel mit Wärmelampe, unter der ich schlafen konnte. Trotzdem gab ich nicht auf und kämpfte mich immer wieder zurück ins Leben. Ich bemühte mich darum, wieder laufen zu lernen und erreichte mein Ziel, auch wenn ich auf Gehhilfen angewiesen war. Als ich sieben Jahre alt war und gerade mit meiner Mutter zu Mittag ass, konnte ich plötzlich ihr Gesicht nicht mehr sehen. Aus heiterem Himmel war ich fast komplett blind geworden, konnte nur noch einige Farben und Hell/Dunkel-Schattierungen erkennen. Das war furchtbar. Die Blindheit war die Folge eines Medikaments, das ich gegen die vermeintliche Tuberkulose einnehmen musste. Erst später erkannte ein Arzt meine Polyarthritis, doch das Augenlicht konnte auch er mir nicht zurückgeben.
Im Alter von 11 Jahren reiste ich mit meiner Mutter nach Genf in eine Klinik, weil mir dort in Aussicht gestellt worden war, meine Augen operieren zu können. Tatsächlich verlief die Operation erfolgreich und ich konnte zumindest auf einem Auge wieder etwas sehen. Doch leider war das Glück von kurzer Dauer. Noch im Krankenhaus passierte ein furchtbarer Unfall: um die Krankenzimmer putzen zu können, wurden damals alle Kinder der Station in ein Spielzimmer gesperrt. Ich hatte ein kleines Auto in der Hand – rot war es, das weiss ich noch ganz genau – und wollte es genauer betrachten. Da kam ein Junge und nahm es mir weg. Er fuchtelte so unglücklich vor meinem Gesicht damit herum, dass er mich ins Auge traf. Es war nicht mehr zu retten. Mein Traum war geplatzt. Ein sehr schwieriger Moment auch für meine Eltern, die so viel Hoffnung, Zeit und Geld in die Operation gesteckt hatten. Damals mussten meine Eltern alles selbst finanzieren, ich war weder versichert, noch gab es IV-Renten.
In der Pubertät wurden zum Glück meine Polyarthritis-Beschwerden ein wenig besser, die Schübe seltener. Ich konnte eine Ausbildung zur Telefonistin machen, eine Tätigkeit, die mir immer sehr gefallen hat. Übers Telefon lernte ich später auch meinen Mann kennen. Er ist der Vater meines Sohnes Daniel. Leider verliebte er sich in eine andere und verliess uns, als Daniel zehn Jahre alt war. Von da an waren wir auf uns alleine gestellt. Das war nicht immer einfach, weil ich oft das Gefühl hatte, ihm aufgrund meiner Blindheit nicht all das geben zu können, was andere Eltern ihren Kindern bieten.
Im Rütihof wohne ich seit zwanzig Jahren. Seit Daniel ausgezogen ist, lebe ich alleine. Eigentlich bin ich zufrieden hier, vor allem auch, weil es sehr praktisch ist, direkt an der Endhaltestelle des 46ers zu wohnen: Ich kann an der gleichen Stelle in den Bus ein- und aussteigen. Für Ausflüge in die Stadt muss ich daher meist keine Hilfe von anderen in Anspruch nehmen. Selbstständigkeit ist mir sehr wichtig. Was mich an meinem Wohnort jedoch stört, ist der Lärm – und zwar weniger der Kinderlärm, als vielmehr die ganzen Maschinen: Rasenmäher, Laubbläser – eine ständige Geräuschkulisse. Für mich als Blinde ist das weit störender als für die Sehenden, weil ich erstens stärker auf mein Gehör angewiesen bin als andere und zweitens Geräusche intensiver wahrnehme.
Ich bin aktiv und gesellig und liebe den Austausch mit anderen Menschen. Ich bin viel unterwegs, an Konzerten, Theateraufführungen oder Lesungen. Ganz wichtig ist mir auch mein Engagement im Restaurant «Blinde Kuh». Hier arbeite ich seit der Eröffnung vor rund 20 Jahren, führe die Gäste zu ihren Tischen und serviere das Essen. Die Arbeit im Team bedeutet mir viel, genauso wie die Wertschätzung, die ich von Belegschaft und Gästen erhalte.
Diese Tätigkeit hat mir während des Lockdowns gefehlt. Überhaupt hat mich diese Zeit sehr belastet – und tut es bis jetzt. All meine Aktivitäten brachen von heute auf morgen zusammen und ich war quasi an die Wohnung gefesselt. Ausserdem sind während des Lockdowns alte Wunden wieder aufgerissen: damals, als ich nach der Augenoperation im Krankenhaus war, litt ich unter extremem Heimweh. Ich vermisste die Geborgenheit meiner Familie wahnsinnig. Solch ein Gefühl hat auch der Lockdown in mir hervorgerufen. Das schlimmste aber ist für mich, dass Walter, mein Freund und Partner, an Covid-19 erkrankt und verstorben ist. Ich konnte ihn nicht mehr sehen, nach seinem Krankenhauseintritt nur noch zweimal telefonieren, dann ist er gestorben. Er fehlt mir sehr – die Gespräche mit ihm, die Ausflüge, die wir gemeinsam unternommen haben – wir haben uns immer so gut ergänzt.
Doch ich bin ein gläubiger Mensch und davon überzeugt, dass sich im Leben immer wieder neue Türen öffnen. Ich bin froh, dass ich meinen Bruder und so gute Freundinnen habe, die mir zur Seite stehen. Glücklich bin ich auch über die Beziehung zu meinem Sohn – er ist das Allerwichtigste in meinem Leben. Unser inniges Verhältnis gibt mir sehr viel. Und auch sonst bin ich sehr dankbar: dafür, dass ich trotz meiner Einschränkungen so selbstständig leben kann und dafür, dass sich eigentlich immer dann, wenn ich es brauche, jemand findet, der mir behilflich ist. Das bedeutet mir viel.
In diesen monatlichen Beiträgen werden ganz normale Menschen aus Höngg porträtiert: Man braucht nicht der Lokalprominenz anzugehören und muss auch nicht irgendwelche herausragenden Leistungen vollbracht haben, nein, denn das Spezielle steckt oft im scheinbar Unscheinbaren, in Menschen «wie du und ich».
So funktioniert’s: Die zuletzt porträtierte Person macht drei Vorschläge, an wen der Stab der Porträt-Stafette weitergereicht werden soll. Die Redaktion fragt die Personen der Reihe nach an und hofft auf deren Bereitschaft.

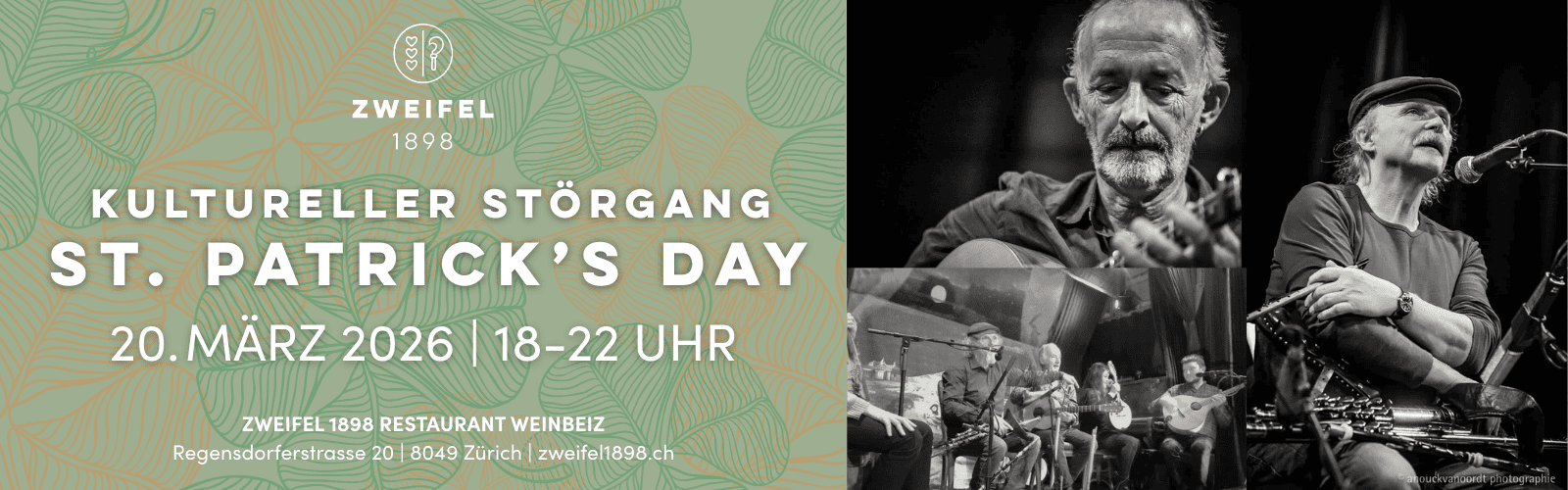


2 Kommentare