Armut
«Das schlechte Gewissen ist ein ständiger Begleiter»
Armutsgefährdete Menschen leben oft unerkannt mitten unter uns. Sie beziehen zwar keine Sozialhilfe, leben aber mit einem so knappen Budget, dass bereits eine Arztrechnung sie in Schwierigkeiten bringen kann.
16. Mai 2018 — Patricia Senn
So hatte sie sich das nicht vorgestellt. Das Kind war geplant, der Vater sollte die erste Zeit zu Hause bleiben, sie weiterhin 100 Prozent arbeiten. So hatten sie das abgemacht. Und sich darauf gefreut. Waren in eine grosse Wohnung in die Agglomeration gezogen. Schön sollte das werden. Ein gesunder Junge kam zur Welt. Doch dann wurde es dem Mann plötzlich zu viel. Nach wenigen Monaten packte er unvermittelt seine Sachen und verliess die junge Familie überfordert. Da stand sie nun. Alleine mit einem Kind und einer viel zu teuren Wohnung. Ihr Arbeitgeber sagte, 100 Prozent oder nichts. Sie fiel in ein Loch, wurde krank, musste auf ein Baby aufpassen, gleichzeitig die Arbeitslosigkeit aushalten und eine Trennung verarbeiten. «Die ersten drei Jahre waren wirklich schwierig». Alleinerziehend zu sein verlangte ihr alles ab. «Da bleibt nicht viel von den romantischen Vorstellungen übrig, die man davon hat, wie es ist, ein eigenes Kind zu haben», erzählt die gepflegte Frau, die ihren Namen nicht in der Zeitung lesen möchte. Sie sitzt in ihrer kleinen Küche – erst vor kurzem konnten sie endlich in eine Genossenschaftswohnung im Kreis 10 umziehen, eine riesige Entlastung, nicht nur finanziell – mit ihrer weissen Bluse und den schwarzen Hosen sieht sie aus, als würde sie gleich zur Arbeit aufbrechen. Irgendwie schaffte sie es, eine 80 Prozent-Anstellung zu finden. Als sie vom Patenschaftsprojekt «mit mir» der Caritas Zürich hörte, war das ein Rettungsanker, nach dem sie ohne zu zögern griff. Die Organisation vermittelt Freiwillige an von Armut betroffene Familien. Ein- bis zweimal im Monat verbringen die sogenannten Patinnen und Paten einen halben oder ganzen Tag mit ihrem Patenkind. Sie unternehmen kleine Ausflüge, besuchen ein Museum, gehen spazieren, lesen Geschichten vor, solche Sachen. Anfangs waren es nur ein, zwei Stunden wöchentlich, in der eine Patin Zeit mit ihrem Sohn verbrachte, «doch das war bereits eine grosse Entlastung, eine kleine Pause, um Luft zu holen». Mittlerweile ist die Patin zu einer Bezugsperson ihres Jungen geworden.
Filterkaffee und Brockenstube
Inzwischen hat die Mutter auf 70 Prozent reduziert, dadurch hat sie weniger Geld zur Verfügung, als wenn sie Sozialhilfe beziehen würde. Zum Sozialamt will sie trotzdem nicht, denn: «meine Mutter hat ein Sparkonto für meinen Sohn eingerichtet. Dieses müsste ich bis auf einen Freibetrag aufbrauchen, wenn ich Sozialhilfe beantragen wollte». Ausserdem gefalle ihr der Gedanke nicht, von anderen abhängig zu sein. Lieber verzichtet sie auf neue Möbel und Kleider, «da ich ohnehin eine Brockenstuben-Liebhaberin bin, fällt mir das nicht besonders schwer», meint sie und lächelt. Ihr Sohn sei in einem Alter, in dem coole Schuhe und Kleider noch nicht so wichtig seien, daher störe ihn das auch nicht. Auch beim Kaffee macht sie Abstriche: «Ich trinke nur noch Filterkaffee. Das machen die Hipster heute ja auch», lacht sie. Manchmal aber fällt ihr der ständige Verzicht schwer. Dann besucht sie dennoch ein hübsches Bistro und trinkt eine Tasse «richtigen Kaffee», die dann eben fünf Franken kostet. «In solchen Momenten denke ich, ich arbeite doch, habe ich das nicht auch verdient? Aber das schlechte Gewissen bleibt halt immer». Trotzdem: Es gehe ihr gut, viel besser als früher. «Dank der KulturLegi der Caritas Zürich können wir auch am sozialen Leben teilnehmen», erzählt sie. «Am Dienstag haben mein Sohn und ich frei, dann gehen wir ins Museum oder ins Hallenbad. Der Junge liebt die Pestalozzi Bibliothek, dort dürfen wir für ihn gratis Bücher ausleihen». Manchmal fragt sie Freunde an, ob sie babysitten könnten, damit sie am Abend einen Gelegenheitsjob wahrnehmen kann. «Aber das geht natürlich nicht oft». Glücklicherweise kann sie ab und zu Nahrungsmittel von ihrem Arbeitgeber mit nach Hause nehmen. «Das hilft uns enorm», sagt die Mutter, «gesundes Essen ist mir sehr wichtig, dort möchte ich nicht sparen müssen. Lieber verzichte ich auf andere Dinge». Gerne würde sie wieder aufstocken bei der Arbeit, aber das sei bei ihrem Arbeitgeber nicht möglich. Manchmal beschleicht sie die Angst, dass sie zu denen gehören könnte, die mit 55 Jahren keinen Job mehr bekommen. «Ich habe die Matur, einen Lehrabschluss und eine weitere Schule abgeschlossen. Meine Ausbildung ist gut. Dennoch muss ich im Geschäft darum kämpfen, dass auch ich Weiterbildungen besuchen darf. Aber ich habe sie jetzt gekriegt, die Weiterbildung», fügt sie stolz an.
Die anderen sind die Armen
Ja, ihr Umfeld wisse schon, wie es ihr finanziell gehe, sagt sie. «Manche Leute wenden sich ab, weil ich halt nicht alles mitmachen kann. Aber das kommt sehr selten vor». Am schwierigsten sei eigentlich der Verzicht auf Ferien. Das letzte Mal waren sie vor anderthalb Jahren weg, ein unglaubliches Schnäppchen sei das gewesen: billiger Flug, Hotel für 20 Franken am Tag. Bezahlt mit dem 13. Monatslohn. «Eigentlich mag ich einfache Ferien, zelten in der Schweiz zum Beispiel. Aber das ist nicht unbedingt billiger als solche Pauschalangebote», sagt die Frau. Klar fragt sie sich manchmal, ob sie früher mehr hätte sparen sollen. Aber dieses Hadern bringt nichts. «Es könnte schlimmer sein», meint sie, «wir sind gesund. Mein Sohn ist intelligent und lustig. Ich bin spät Mutter geworden und habe das Leben davor in vollen Zügen genossen, viel erlebt, viel gesehen. Eigentlich vermisse ich nichts». Nein, sie fühle sich nicht am Rande der Gesellschaft. Obdachlose, Bettler oder Suchtkranke, das seien die wirklichen Armen.
Und für die Zukunft?
Für ihren Sohn hofft sie, dass er jede Ausbildung machen kann, die er möchte. Vor Kurzem seien sie an der ETH vorbeigefahren und sie habe, nur halb im Scherz, zu ihm gesagt: «hier gehst du mal zur Schule». Dass Bildung sehr wichtig ist, hat sie am eigenen Leib erfahren. Das könne aber auch eine Lehre sein. Sie selber wünscht sich, zehn Prozent mehr arbeiten zu können, das alleine wäre eine grosse Entlastung, so müsste sie nicht jeden Monat das Konto überziehen. «Das Schlimmste haben wir überstanden, das waren die ersten drei Jahre. Heute haben wir Spass zusammen. Zürich hat viel zu bieten, wir wollen hierbleiben so lange es geht. Und wenn der Sommer kommt, ist es in der Stadt ja auch ein wenig wie in den Ferien».


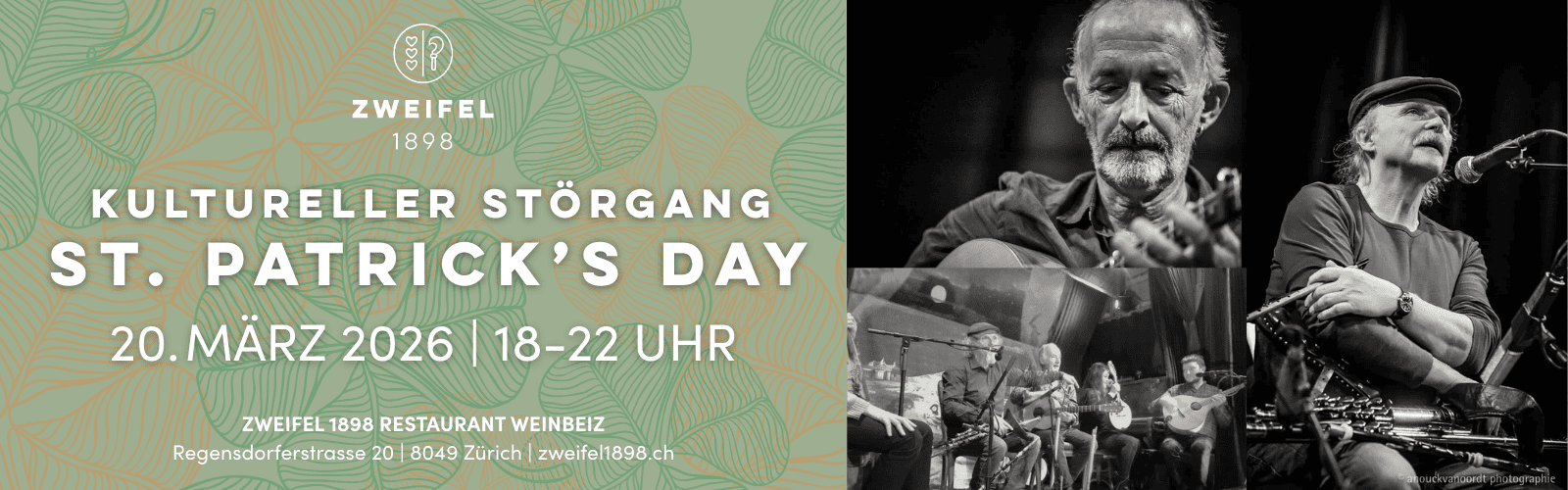

0 Kommentare