Kultur
«Poetry Slam ist mein Ventil»
Anfangs November findet die 22. deutschsprachige Poetry-Slam-Meisterschaft in Zürich statt. Ein Anwärter auf den Titel wohnt in Höngg: Gregor Stäheli ist seit fast zehn Jahren erfolgreicher Spoken Word Poet.
24. Oktober 2018 — Patricia Senn
Man unterstellt den wortgewandten Schnellredner*innen, die sich dem Poetry Slam verschrieben haben, gemeinhin hohe Intelligenz und ein omnipotentes Wissen über Gesellschaft, Politik und Menschliches. Man denkt an Hazel Brugger und Gabriel Vetter, die mit einer beneidenswerten Beobachtungsgabe ihre Umwelt und ihr eigenes Innenleben sezieren, um dann die Filetstücke gesalzen und gepfeffert zu präsentieren. Oder eben zu performen. So wie das auch Gregor Stäheli macht. Bald zehn Jahre ist es her, als der gebürtige Basler zum ersten Mal an einem «Slam» auftrat. Ein Slam ist ein Wettbewerb, an dem die «Poet*innen» mit ihren Texten gegeneinander antreten und eine Jury sowie das Publikum entscheiden, wer gewinnt. Was er damals nicht wusste: Es handelte sich um ein U20-Kantonsfinale, das bedeutete in diesem speziellen Fall, dass sich der oder die Gewinner*in automatisch für die Schweizer und die deutschsprachige Meisterschaft qualifizierte. Am Ende des Abends hatte der Debütant seinen ersten Sieg und eine Einladung nach Düsseldorf an die U20-Meisterschaft in der Tasche. «So fing das alles an», erzählt Stäheli am Küchentisch der «Höngger» Redaktion, «und hat seither nicht mehr aufgehört». Die Fotos auf seiner Website zeigen einen coolen, etwas unnahbaren jungen Mann, ein Eindruck, der sich gleich beim ersten Händedruck revidiert. Er sei ein schüchterner Junge gewesen, bis er ans Gymnasium kam und sich zu einer Art Klassenkasper entwickelt habe, nicht immer zur Freude der Lehrer, wie er mit einem Grinsen zugibt. In den sprachlichen Fächern sei er, ausser im Englischunterricht, eigentlich auch nicht aufgefallen, zumindest bekamen seine Aufsätze keine aussergewöhnlich guten Noten. Zum Schreiben kam er erst mit 18 Jahren durch einen Poetry-Slam-Workshop, den der Deutschlehrer organisierte. Die beiden Kursleiter, die damals schon erfolgreichen Spoken Word Poets und Organisatoren Phibi Reichling und Richi Küttel, ermutigten ihn, an den Wettbewerben der U20-Liga teilzunehmen. «Das ist ein guter Einstieg, man muss nicht gleich gegen die <Grossen> antreten und kann sich selbst ausprobieren». Er kann sich noch lebhaft an dieses erste Mal erinnern, an die Nervosität, die er bis heute nicht ganz abgelegt hat, die Ehrfurcht vor den anderen. Doch die Szene sei überschaubar und sehr familiär, «Slamily» nennen sie die Leute, die ihr angehören. «Bis auf die wenigen Minuten auf der Bühne ist das Umfeld überhaupt nicht kompetitiv, man spürt keine Missgunst, im Gegenteil, die Leute sind sehr wohlwollend», meint Stäheli. Seine früheren Idole sind mittlerweile gute Freunde geworden, wie der Oltener Kilian Ziegler, der dieses Jahr die Schweizer Meisterschaft gewonnen hat. «Wir sind fast täglich in Kontakt, schicken uns unsere Texte zum Gegenlesen. An seinen Leistungen kann ich auch meine eigene Entwicklung messen». Im Gegensatz zu den «Popstars» wie Hazel Brugger, Gabriel Vetter oder Lara Stoll, trete Kilian Ziegler noch immer sehr häufig an Slams an. Er sei wahnsinnig spontan und witzig, meint Stäheli anerkennend, das sei auch die Richtung, die er für sich selber weitergehen wolle. «Ich möchte lustig sein und das Publikum unterhalten, aber mit einem gewissen Tiefgang».
«(…) ich fand den Sinn des Lebens, und alle roten Fäden, die ich je verloren hatte, und ich fand Walter. (…) Ich lebte in Wäldern und wurde von Wölfen grossgezogen, und zog dabei gleichzeitig selber ein Löwenbaby gross und auf dem Löwen ritt ich nach Narnja und liess ihn da stehen. Ich tötete Voldemort und gewann die Hunger Games, ich trank aus dem Heiligen Gral und rammte einen Eisberg gegen die Titanic, ich fesselte Christian Grey an einen Baum und peitschte ihn aus» (Auszug aus «Siegertyp»).
Wenn er nicht gerade auf der Bühne steht oder einen Slam moderiert, was zu Spitzenzeiten bis zu dreimal in der Woche vorkommen kann, arbeitet er in der Marketing Abteilung einer Versicherung. Regelmässig leitet er auch selber Workshops an Schulen, dazu, wie man Themen und den eigenen Stil findet, Texte aufbaut, Schreibblockaden löst. Das alles unter einen Hut zu bringen, kann ganz schön anstrengend sein, körperlich und mental, «aber mittlerweile ist das ein Ausgleich, den ich brauche. Man entwickelt auch eine Art Mitteilungsbedürfnis und braucht die Slams als Ventil». Wie viel von ihm steckt denn in einem solchen Text? «Meine Geschichten haben immer etwas Persönliches, auch wenn sie teilweise überspitzt und stilisiert sind», erklärt Stäheli. Manchmal fällt es den Zuschauer*innen scheinbar schwer, zwischen der Bühnenperson Gregor Stäheli und der Privatperson zu unterscheiden: «Eine Zeitlang habe ich viel über das Single-Dasein geschrieben. Da kamen die Leute nach einem Auftritt auf mich zu, und redeten mir gut zu, dass das schon noch klappen würde mit den Frauen», erzählt der Slammer «da musste ich dann auch relativieren und sagen, hey Leute, es geht mir wirklich gut!». Aber etwas zu schreiben, das gar nichts mit einem selber zu tun habe, wirke einfach nicht authentisch. Bei den jungen Spoken Word Poeten beobachtet er, dass sie sich intensiv mit sehr ernsten und schweren Themen wie Rassismus, Sexismus und Gewalt beschäftigten. Es sei einerseits faszinierend, zu sehen, wie reflektiert diese jungen Menschen schon seien, «andererseits möchte man ihnen manchmal fast gut zureden, wenn es dann gar düster wird». Ob es bei der Themenwahl Grenzen des guten Geschmacks gebe, Dinge, die man nicht schreiben dürfe? «Slam Poetry lebt davon, dass es eben, abgesehen von der Zeitvorgabe und dass keine Requisiten angewendet werden dürfen, keine Regeln gibt. Die Texte dürfen durchaus provozieren. Humor, insbesondere Satire, darf meiner Meinung nach vieles», sagt Stäheli.
Das Publikum ist unberechenbar
Die Auftritte sind für Stäheli auch nach bald zehn Jahren noch nervenaufreibend. Extrovertiertheit sei aber, sagt Stäheli, keine Voraussetzung für den Erfolg, im Gegenteil: Er erlebe es oft, dass gerade Leute, die hinter der Bühne kaum ein Wort über die Lippen brächten, auf der Bühne aufblühen und den Laden rocken. «Auf der Bühne ist erstaunlich vieles möglich. Man ist fünf Minuten lang unbesiegbar oder unverletzbar, obwohl man sich exponiert», erzählt der Spoken Word Poet. «Das liegt wahrscheinlich am Adrenalin». Auf der Bühne gebe es nur einen Feind: Die innere, fiese Stimme. «Die sagt dann Dinge, wie <oh, pass auf, jetzt kommt dann gleich die Stelle, die Du immer verbockst> oder <schau mal, der Mann da in der ersten Reihe hat noch kein einziges Mal gelacht>, solche Sachen halt». Zum Glück höre er sie heute nicht mehr so oft. Obwohl Stäheli die Mechanismen eingehend studiert hat, alles über Humor, Timing, Pausen und Pointen weiss: Eine Unbekannte bleibt, und das ist die Reaktion des Publikums. «Gerade, wenn man besonders lange an einem Text gearbeitet hat und ihn selber richtig gut findet, wurmt es einen schon, wenn er dann nur mittelmässig ankommt». Aber die eigene Logik ist eben nicht die der anderen. Und die Texte, die man gerne performed, sind nicht unbedingt die, die gut ankommen.
«(…). Nach dem Essen werfen wir Steine nach Bojen und Stand-Up-Paddlern / und wenn wir schon mal fein essen gehen, dann nehme ich Bundstifte mit, damit wir unser eigenes Tischset malen können / ich schieb Dich im Einkaufswagen durch den Supermarkt, wir zeigen auf wildfremde Menschen und schreien laut raus, was wir über sie denken / ich kaufe Dir einen Schokoladen-Weihnachtskalender und wir essen alle Türchen aufs Mal» (Auszug aus «Peter Pan»).
«Talent ist das eine, aber die Übung, die Weiterentwicklung eines Textes, ist mindestens so wichtig», findet er. «Dass ein Text bei einem Publikum nicht gut ankommt, bedeutet nicht zwingend, dass er schlecht ist. An einem anderen Abend, mit anderen Zuschauer*innen, einer anderen Startposition, kann derselbe Text perfekt funktionieren. Es ist wichtig, eine Hartnäckigkeit und eine Art Mut zu entwickeln, um dran zu bleiben. Auch wenn es Überwindung braucht, es ein zweites Mal zu versuchen und vielleicht noch einmal zu scheitern». Trotzdem dürfe man nicht zu verbissen sein und sich nicht zu sehr abstrafen, wenn es mal nicht klappt. «Denn das passiert jedem immer mal wieder. Manchmal fällt man aus dem Rennen, obwohl man das Gefühl hat, mit dem absoluten Gewinnertext am Start zu stehen. Das ist dann ein rechter Schlag ins Gesicht, den es aber eben auch braucht, damit man auf dem Boden bleibt.»
Seit einem halben Jahr nun wohnt der Wortakrobat in seiner eigenen Wohnung in Höngg. Ihn erinnert das Quartier an Riehen, Basel, wo er aufgewachsen ist. «Es liegt in der Stadt, ist aber dennoch irgendwie ländlich. Ich will nicht auf dem Land wohnen, muss nah am Puls leben, geniesse es aber trotzdem, dass es hier ruhig ist». Er findet es super, dass er nach einem Gig irgendwo in der Schweiz immer noch das letzte Tram nach Hause nehmen kann, und wenn er einen Lieblingsplatz nennen müsste, wäre es wohl die «Terrasse» unterhalb der Reformierten Kirche beim Rebberg. «Aber ich bin noch daran, Höngg kennenzulernen, ich bin gespannt, wie es sich entwickelt», meint er zum Abschied.
Mehr zu Gregor Stäheli
https://www.facebook.com/GregorStaeheliOffiziell/
http://gregorstaeheli.ch/
22. deutschsprachige Poetry-Slam-Meisterschaft. 6. bis 10 November. Neben den Meisterschaftsanlässen bietet der «Slam 2018» ein öffentliches Rahmenprogramm: Themen-Slams, Buchpräsentationen, ein Fussballspiel und zum Ausklang eine Party im «Great Gatsby»-Stil. Ganzes Programm und Tickets unter https://slam2018.ch/programm


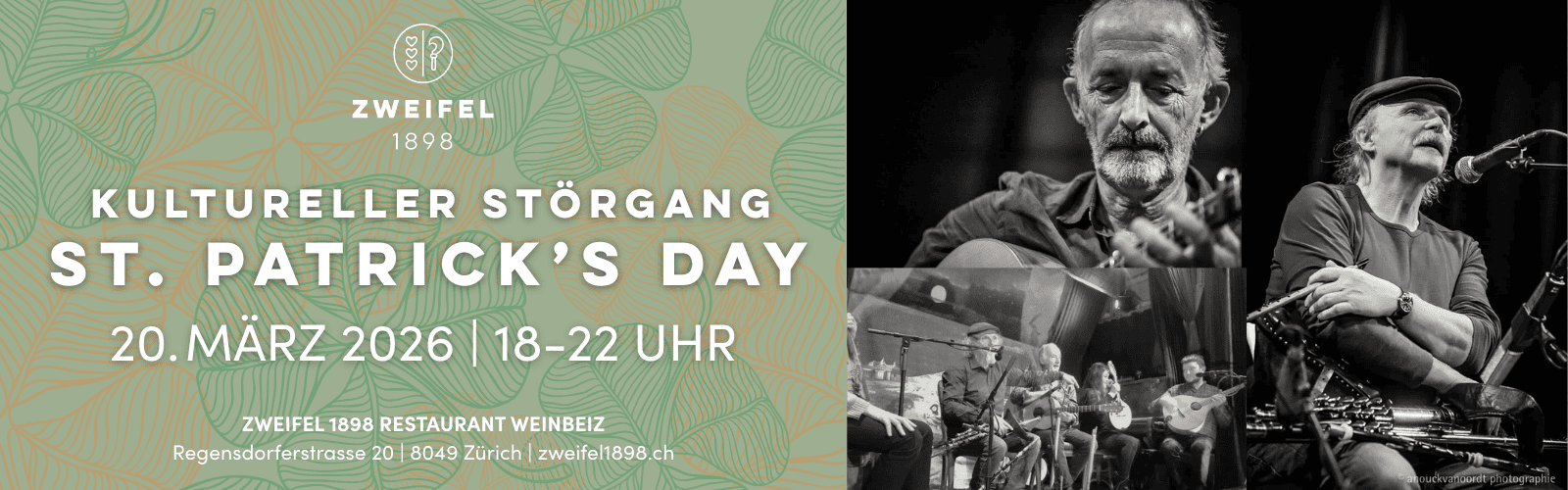


0 Kommentare