Baugeschichte Höngg
«Ich bin glücklich hier»
In die Häuser der Bau- und Siedlungsgenossenschaft Höngg (BSH) werden bald viele neue Menschen einziehen. Aber es gibt auch solche, die schon richtig lange dort wohnen. Einer davon ist Frau Drescher.
15. März 2017 — Patricia Senn
«Nein, nein, lassen Sie die Schuhe ruhig an! Ich putze später sowieso». Frau Drescher, die freundliche Dame mit kurzen, weissen Haaren, ist nicht kompliziert. Seit über 40 Jahren lebt sie in der Bau- und Siedlungsgenossenschaft und will hier auch bleiben «bis sie mich mit den Füssen voran hinaustragen», wie sie mit einem verschmitzten Lächeln sagt. In der grosszügig geschnittenen 2,5 Zimmer-Wohnung ist es warm und hell, auf dem Tisch stehen frische Blumen und in Kistchen auf dem Balkon wächst Nüsslisalat – oder «Rapunzel», wie man in Thüringen sagt, wo die Pensionärin ursprünglich herkommt. Gleich gegenüber ist die 2. Bauetappe der Bau- und Siedlungsgenossenschaft in vollem Gange, «aber wenn die Fenster zu sind, hört man davon eigentlich fast nichts», meint sie. Wahnsinnig neugierig sei man gewesen, was es Neues gäbe, man habe es sich gar nicht richtig vorstellen können, auch wenn man die Pläne ja gesehen und über das Modell abgestimmt hatte. Etwas skeptisch sei sie schon gewesen, schliesslich konnte es bereits in den alten Häusern mit nur sechs Parteien zu Spannungen kommen, wenn es um die Waschküche oder das Putzen ging, wie würde das erst mit so viel mehr Menschen werden? «Doch meine Bedenken waren bald zerstreut, ich bin angenehm überrascht», meint sie zufrieden und legt ihre gepflegten Hände auf die Tischdecke.
Das waren noch Zeiten
Als sie 1974 für eine Arbeitsanstellung in der Hauspflege, damals noch dem Frauenverein unterstellt, nach Höngg kam, suchte sie als Alleinerziehende mit ihrem zwölfjährigen Sohn eine Bleibe. «Beim Vorstellungsgespräch zeigte der damalige Präsident viel Verständnis für meine Lage», erzählt sie, «aber gerade sei keine Zweizimmerwohnung frei, ob ich nicht drei Zimmer haben wolle. Ich entgegnete, ich hätte nur 400 Franken zur Verfügung, worauf er sagte: <Dafür kriegen Sie bei uns fast eine Fünfzimmerwohnung>. Also habe ich mich bei der Genossenschaft angemeldet». Eine Woche später konnte sie bereits eine Wohnung anschauen gehen und zog wenig später ein. Damals galt noch die Auflage, dass einer Mutter mit Sohn eine Dreizimmerwohnung zur Verfügung gestellt wurde, während sich eine Frau mit einer Tochter zwei Zimmer teilen musste, da man davon ausging, dass die beiden Frauen im selben Raum schlafen können. Im ersten Moment sei es ein Schock gewesen, die Wohnung sei ziemlich runtergekommen gewesen. «Die Genossenschaft hat dann im Wohnzimmer neue Tapeten machen lassen, bei den beiden Schlafzimmern musste man noch mit Radiergummi ran, bis sie in den 90er Jahren auch neu tapeziert wurden». Es gab ein altes Küchenbuffet bis rauf zur Decke, aber keinen Kühlschrank. Dafür einen Kasten unter dem Fenster, darin waren Röhren, die es durch die kalte Aussenluft im Winter ordentlich kühl hielten und es im Sommer wenigstens etwas weniger heiss werden liessen. Die selbständige Frau wusste sich zu helfen: Vom Geld, das sie dank der tiefen Miete sparte, kaufte sie sich einen Kühlschrank und liess auch ein paar Stromleitungen legen – in den Zimmern hatte es gerade einmal zwei bis drei Steckdosen. Immerhin gab es schon ein Badezimmer mit Badewanne. Einige Jahre später wurden die Wohnungen schliesslich mit Einbauküchen versehen und der Boiler kam auch raus. Wenn man am Abend vergass, den Schalter am Herd auf «Boiler» umzustellen, hatte man am nächsten Tag kein warmes Wasser. «Alles war sehr einfach, aber halt auch günstig», erinnert sie sich. Man hatte «Ämtli» im Haus, die heute ein Hauswart erledigt. Treppenhaus putzen, Schnee schaufeln, Laub fegen. «Der Zusammenhalt war gut in der Genossenschaft, man hat sich für die Gemeinschaft engagiert, sogar die Kinder folgten dem Beispiel. Wenn jemand krank war, machte man einen Krankenbesuch». Eine Zeit lang ging das Gemeinschaftliche etwas verloren, aber heute sei das Verhältnis unter den Genossenschaftern wieder gut. «Und wenn man in einem Haus zusammenlebt, muss man immer Kompromisse machen. Nur bei der Ordnung ist es wichtig, dass das nicht aus dem Ruder läuft, in den gemeinschaftlich genutzten Räumen. Aber man sollte grosszügig sein können, wenn man auch nicht immer mit allem einverstanden ist».
Zuversicht gewinnt
Dass sich das Frankental stark verändert hat, ist der lebhaften Dame natürlich nicht entgangen, «aber, wenn man immer hier wohnt, fällt einem das nicht so stark auf, man wächst ja mit». Zum verdichteten Bauen hat sie eine pragmatische Einstellung: «Es braucht nun mal Wohnungen. Der Bodenpreis ist teuer und gleichzeitig kann man auch nicht jedes Stücklein Erde verbauen. Also muss man in die Höhe», sagt sie, als wäre das nun wirklich nicht so schwer zu verstehen. Noch gebe es in Höngg genügend alte Wege, auf denen sie gerne spazieren gehe. Und natürlich den Hönggerberg. «Wir sind mit dieser Lage wirklich sehr privilegiert. Ich bin sehr glücklich hier», sagt Frau Drescher. Sie, die sich als kleines Mädchen in Deutschland noch vor Luftangriffen fürchten musste, ist heute über ein frisches Mittagessen genauso entzückt wie über die erste Blume im Frühling. Das Jammern liegt ihr nicht. «Ich halte es wie meine Grossmutter, die immer sagte: <Geht einmal eine Türe zu, geht irgendwo bestimmt ein Fenster auf>». Diese Zuversicht hat sie sich zu eigen gemacht und bis ins hohe Alter bewahrt. «Die Neugierde und interessante Gespräche mit Bekannten und Freunden halten mich jung», resümiert sie, «und im <Dorf>, wie ich immer noch sage, wird uns wirklich viel geboten. Da muss niemand alleine bleiben, wenn er oder sie nicht will. Nur rausgehen muss man selber. Von nichts kommt ja bekanntlich nichts». Sagt’s und stellt sich in die Küche. Heute gibt es Kefen mit Poulet.


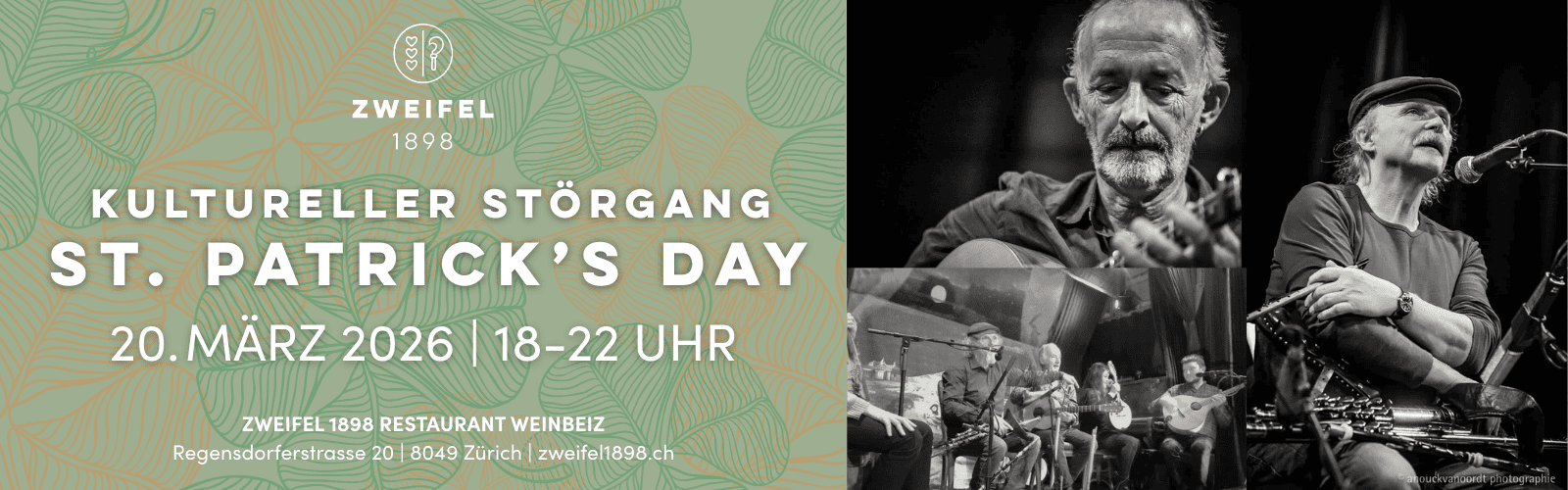


0 Kommentare