Quartierleben
6 x 75 Jahre in Höngg – Teil 3
Im zweiten Teil erzählten die sechs Hönggerinnen von ihrer Kindheit in Höngg, Erlebnissen mit Schulkameraden, Schulhausabwart Schlumpf und verbotenen Ausflügen in Bäckereien. Dann tauchten unvermittelt Erinnerungen an die Kriegsjahre auf – Teil drei berichtet davon.
20. Mai 2010 — Fredy Haffner
Erika Ringger-Mayer war es, die sagte: «Ich wuchs an der Hohenklingenstrasse auf, während des Krieges kaufte mein Vater zwischen Segantini- und Bergellerstrasse ein Stück Land, einen ‹Pflanzblätz›. Da waren nur zwei kleine Wege, aus denen dann erst 1949 die Segantinistrasse und 1966 die Bergellerstrasse wurden. Im Krieg kostete der Quadratmeter dort 12 Franken, das Stück Land daneben 15, doch das war meinem Vater bereits zu teuer.» Der Wunsch des «Hönggers», doch noch einen Moment bei den ‹Pflanzblätzen› zu verweilen, ging im allgemeinen Stimmengewirr unter, als wäre nun ein Damm gebrochen, und schnell war man bei den Früchten der Arbeit angelangt: «Wenn meine Mutter jeweils sagte, ich solle das Nachtessen bereitstellen», erinnerte sich Margrit Furrer-Hartmann, «so musste ich nicht fragen ‹was›: Ich schälte einfach Kartoffeln, denn es gab immer Röschti und Salat zum Znacht. Vielleicht mal etwas Käse oder ein Spiegelei dazu. Aber das Essen war auch gar nicht so wichtig. Jedenfalls litten wir nie Hunger.» Und das bestätigten alle in dieser Runde. Man wusste sich auch ausserhalb von Höngg etwas zu beschaffen: «Meine Eltern waren Bündner», erklärte Margrit, «wenn ich dort bei Verwandten in den Ferien war, musste ich vor der Rückreise bei allen vorbei, weil die dachten, wir in der Stadt hätten Hunger. Deshalb wurden mir die Taschen mit Speck, Butter, Käse und so weiter gefüllt – im Zug versuchten dann alle herauszufinden, wo der Duft her kam und ich war furchtbar stolz, dass ich Essen mit nach Hause brachte.» Das Alltagsessen sei jedoch nicht immer wirklich gut gewesen, warf Leonie von Aesch-Weinmann ein: «Das Brot mit diesen ‹Fäden› darin, das Kartoffelbrot . . . » – «Und frisch war das auch nie», unterbrach Ursula Volkart-Lahme, «es musste ja zwei Tage alt sein, bevor der Bäcker es verkaufen durfte, denn frisches Brot hätte man zu schnell und zu viel davon gegessen – so nahm man wenigstens an.»
Man war fast Selbstversorger
Zuhause gab es, was im Garten an Gemüse, Obst und Beeren wuchs. Beinahe Selbstversorger sei man so gewesen: Das Obst aus dem Garten wurde eingemacht, und auf den Feldern durfte man Ähren zusammenlesen: «Oben im Rütihof, ich glaube, das war auf den Feldern von Geering», erzählte Erika und fügte an, wie ihre Mutter extra eine kleine Mühle kaufte und die Körner zu einer Extraportion Mehl verarbeitete. Elsbeth Hubers Familie dagegen hatte Hühner, denen sie diese Körner verfütterte und so zu mehr Eiern kam, die sie wiederum gegen andere Lebensmittelmarken eintauschen konnte. «Überhaupt war da immer ein reger Tauschhandel», erzählte sie und breitete mit der Erinnerung gleich die damals nicht eingelösten Lebensmittelmarken vor sich aus. Offiziell durfte nur mit diesen eingekauft werden. Geld alleine reichte nicht, man musste zum Geld auch noch die entsprechenden Marken abgeben können. Marken, für die man keinen Gebrauch hatte, tauschte man gegen andere ein. Zum Beispiel die Mahlzeitencoupons für einen Restaurantbesuch: Das Geld dafür vermochten die wenigsten auszugeben, oder man brauchte es lieber für etwas anderes, also tauschte man die Coupons ein. Konnte man nicht tauschen, behalf man sich anderweitig, wie Ursula erzählte: «Dort wo heute das Wasserwerk ist, bei der Tüffenwies, war eine städtische Dörranstalt, in der man sein gerüstetes Obst trocknen lassen konnte.» Und die Ausflüge mit dem Leiterwagen über das «Brüggli», wie die aus dem Jahr 1874 stammende Vorgängerin der 1964 erstellten Europabrücke im Volksmund genannt wurde, sind nicht nur ihr in lebendiger Erinnerung geblieben.
Im Sommer für den Winter vorgesorgt
Was man im Sommer an heimischem Obst nicht verzehrte, wurde eingemacht oder gedörrt. Exotisches gab es nicht. Oder dann nur aus sonderbaren Quellen: «Wisst ihr noch die Schweinemästerei von Ernst Möckli an der Imbisbühlstrasse hinten?», warf Leonie in die Runde, «Möckli (siehe Kasten) holte in der Stadt bei den grossen Hotels oder den Comestible-Geschäften die Abfälle für seine Schweine. Seine Frau suchte daraus die noch geniessbaren Bananen und Orangen raus und verteilte sie an uns Kinder. Das war das grösste Fest!» Möglichst gerecht wurde alles geteilt, so auch die Butter jeden Morgen: «Mutter liess die Milch in einem weiten Becken über Nacht stehen, am Morgen konnte man den Rahm oben abschöpfen, Butter daraus machen und jeder bekam ein genau gleich grosses Stück.»
«Zur Person»
Ernst Möckli, 1886 bis 1958, war Sekretär des Schweizerischen Unteroffiziersverbandes und schärfster Gegner von Pfarrer Trautvetter, von dem in einer der nächsten Folgen noch die Rede sein wird.




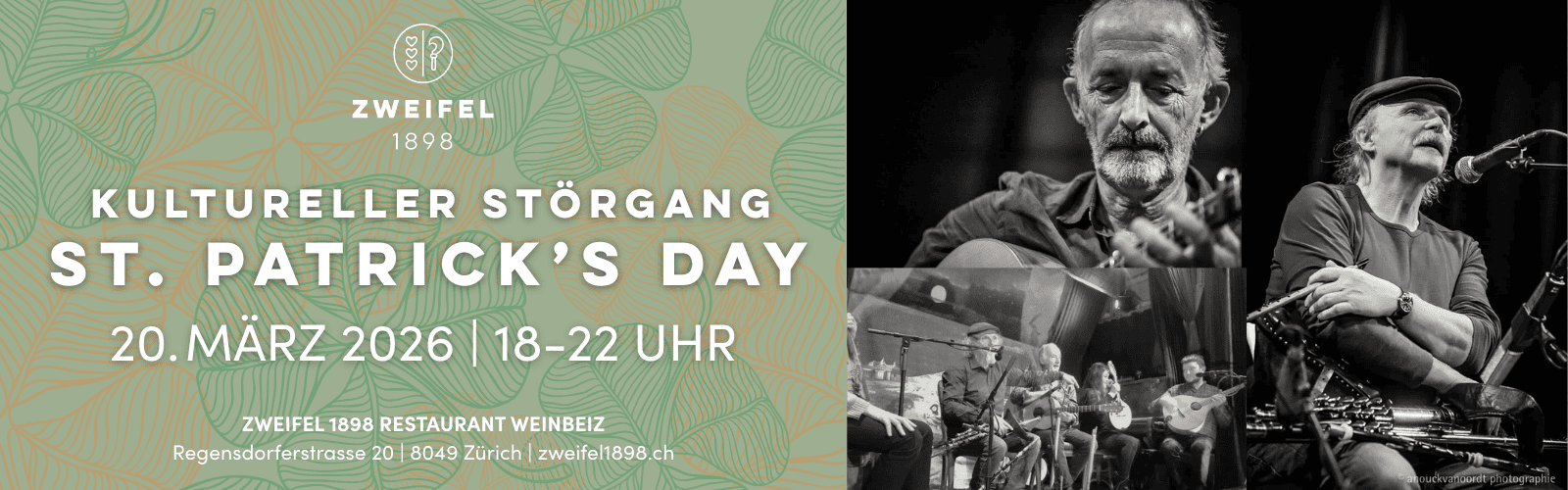
0 Kommentare