Quartierleben
Emil Steinberger: «Chunsch öppe vo Höngg?»
Am 11. März tritt Emil in Höngg auf. Im grossen Interview spricht er über Sonnensystem, Berufswahl, Erfolg, Einbürgerungspraxis, Musicals und Einswerdung. Und rätselt über die Frage, warum jemand wohl «öppe vo Höngg» kommt.
5. März 2009 — Fredy Haffner
«Höngger»: Herr Steinberger, als Sie ein Jahr alt waren, wurde Höngg von der Stadt Zürich eingemeindet. Für Sie sicher ein prägendes Erlebnis!
Emil: (lacht herzlich) Ja, Fusionierungen von Städten und Gemeinden! Gerade gestern erzählte ich meinem Publikum, dass ich schon als Luzerner Schüler immer neidisch war auf Winterthur: Hatten wir 50 000 Einwohner, so hatte Winterthur 60 000 – und wenn wir dann 60 000 hatten, war Winterthur bei 70 000 angelangt. Und jetzt, so sagte ich, habt ihr 100 000! Aber ihr habt ja auch eingemeindet, wartet bloss: Wir Luzerner kommen schon noch, wir holen auf. Sie sehen, das Thema hat mich tatsächlich schon früh bewegt.
Man sagt, Sie seien schon in der Schule oft der Pausenclown gewesen, nicht immer zur Freude der Lehrer. Mussten Sie viel nachsitzen?
Unterschiedlich. Mein Banknachbar bekam mehr Strafen, denn bestraft wurde, wer lachte – und ich konnte es mir immer verkneifen, schon damals. Doch einmal stellte mich ein Lehrer tatsächlich vor die Türe, und zwar, als er das Sonnensystem erklären wollte. Dabei hatte ich gar nichts getan! Nach der Stunde fragte ich ihn und er antwortete: «Ja, Emil, du hast nichts getan, aber wenn ich dein Gesicht sehe, dann muss ich einfach lachen und dann kann ich kein ganzes Sonnensystem erklären.» Oder einmal, der Lehrer kam viel zu spät, da spielte ich eben den «Zügelmann“ und versuchte das Lehrerpult zu verschieben. Die Klasse brüllte vor Lachen und niemand hatte den offenen Türspalt bemerkt und des Lehrers Nase darin. Ich verbrachte dann zwei unfreie Mittwochnachmittage im Schulhaus.
Ihren Beschluss dann, im ersten Beruf Postbeamter zu werden, bezeichneten Sie selber einmal als «verrückt». Warum gerade «verrückt»?
Ich hatte im Alter von 17 Jahren keinen konkreten Berufswunsch. Nichts, von dem ich mit Überzeugung hätte sagen können: Das will ich werden. So war dieser Entscheid in sich einfach «verrückt». Auch später blieb das so: Ich war mir selber irgendwie immer zehn Jahre hinterher. Wahrscheinlich ist das auch heute noch so! Mal schauen, was in zehn Jahren sein wird.
Aber das geht heute noch vielen jungen Menschen genau gleich: Sie kommen aus der Schule und wissen nicht, was sie wollen… und dann, was machen sie? Sie gehen weiter in die Schule. Ist ja nicht das Dümmste, lernen kann man immer…
Zum Beispiel 3000 Poststellen, damals alle noch ohne Postleitzahl, wie Sie sie lernen mussten? Hat das Ihr Gedächtnis geschult, um später Bühnentexte besser einstudieren zu können?
Nein, im Texte Memorieren bin ich kein Hirsch. Bei meinen ersten Auftritten hatte ich überall Spickzettel, schrieb mir gar Worte direkt auf den Tisch. Ich probe nicht gerne und lerne nicht gerne auswendig, das ist bis heute so. Vielleicht haben diese 3000 Poststellen einfach zu viel Kraft aus meinem Hirn abgezogen, die ich für anderes hätte brauchen können?!
1977 waren Sie mit dem Zirkus Knie auf Tournee, ein unvergesslicher Auftritt. Ein zweites Engagement haben Sie konsequent abgelehnt. Was war der Grund?
Ein Grund war, dass man für eine solche Tournee andere Dinge aufgeben muss. Man kann nicht nebenbei Theater machen, ein Kino betreiben und wer weiss noch was alles tun. Der Hauptgrund für meine Weigerung aber war der gewaltige Erfolg. Die Leute waren so begeistert! Was immer auch ich neu gebracht hätte, sie hätten es mit dem ersten Auftritt verglichen. Und etwas Gleichwertiges oder gar Besseres zu bringen, das ist nicht einfach, denn beim ersten Mal trägt nebst Inhalt und Qualität einer Nummer auch die Überraschung zum Erfolg bei: Die Verblüffung darüber, wie da einer Eiscrème verkauft – das hatte man im Zirkus so einfach noch nie gesehen. Diesen Erfolg wollte ich so stehen lassen, nicht angreifen.
1978 spielten Sie in «Die Schweizermacher» den jungen Einbürgerungsbeamten. Wie sehen Sie diesen Film und Ihre Figur darin im Licht der heutigen Einbürgerungspraxis?
Topaktuell. Ich habe den Film 25 Jahre nach Erscheinen in New York gesehen: Das Publikum hat gelacht wie verrückt und ich habe mich geschämt! «Gopfriedstutz», habe ich gedacht, «hat sich denn gar nichts geändert?» Es ist verrückt: Damals, als der Film raus kam, da wusste die Schweizer Seele, dass es so nicht richtig ist. Wir lachten über unsere eigene Dummheit und trotzdem machten wir es so und tun es noch heute. Mit der Einbürgerung ist es so wie mit der Partei, die so tut, als wäre sie Volkes Stimme, um dann die Abstimmungen zu verlieren: Ich kann sprechen mit wem ich will, alle finden das System furchtbar und trotzdem existiert es weiter! Klar gibt es viele Probleme. Wer hätte gedacht, dass eines Tages so viele Afrikaner nach Europa kommen? Wie auch? Aber sie kommen zu Tausenden, viele mit gutem Grund, doch das muss man schon regeln. Es ist ein heisses Problem und menschlich ist es manchmal grausam falsch, was da passiert. Was ich aber besonders empfinde: Einbürgerungen sind Sache der Gemeinden und jede bestimmt selber, wer Schweizer werden darf. Das gibt es doch nicht! Es müsste doch ein für die ganze Schweiz gültiges Kriterium geben und nicht dieses «Hier so und dort anders». Das ist so doch nicht gelöst – ja, «Die Schweizermacher» sind heute noch sehr aktuell.
Sie haben New York angesprochen: 1987 stoppten Sie für Ihre Fans überraschend Ihre Karriere als Bühnenfigur Emil. 1993 verliessen Sie die Schweiz und siedelten nach New York in die USA über, weil Sie hier keine Ruhe fanden. Wie kamen Sie ausgerechnet auf New York? Die Stadt ist ja nicht gerade für ihre Ruhe berühmt?
Es war auch nicht diese Art der Ruhe, die ich gesucht hatte, sondern eine Ruhe in mir. Ich war als Mensch so in einer Umklammerung gefangen, dass ich nicht mehr wusste, welche Lebensform ich noch annehmen sollte. Ich musste mich mal befreien, ich wollte ein Niemand sein und geniessen können. Ich hatte immer nur gegeben und gegeben – mit allen Sachen, mit Kleintheater und Kino, ich habe programmiert für die Künstler und selber gespielt, all die Tourneen, verrückte, rastlose Zeiten und ich fand: Jetzt gehört mal etwas mir. New York ist eine gute Stadt, sie ist schön weit weg, man konnte mich nicht einfach holen wie aus Paris oder so. Der Entscheid war schnell gefällt: Wohin? New York. Fertig.
Haben Sie damals in New York Kleinkunstbühnen besucht?
Amerika kennt keine Kleinkunstszene wie wir in der Schweiz, diese Vielfältigkeit an selbständigen Bühnen hier! Mimen, Clowns, Jazz, all das «Zeugs» in einem Theater, so wie hier gibt es das dort nicht. Ich habe Musicals und solche Sachen besucht, das war einzigartig.
Welches beeindruckte Sie besonders?
Meine Frau und ich waren eben wieder 14 Tage dort und haben sechs Musicals gesehen. Die Qualität ist umwerfend. Auch inhaltlich: Es ist nicht einfach oberflächlich, wie früher die Operetten. Zum Beispiel «Billy Elliot», das Musical zum Film, sensationell, ganz toll. Dann sahen wir noch «Frühlings Erwachen» von Frank Wedekind – das er übrigens im ersten Entwurf Ende 19. Jahrhundert in Zürich verfasste – das war auch sehr gut gemacht, dramatisch gesungen, mitreissend inszeniert, man sitzt in der dritten Reihe und dann geht es los!
Gutes Stichwort: Am 11. März legen Sie mit Ihrem Programm «Drei Engel» in Höngg los. Wie geriet ausgerechnet Höngg in Ihren Tourneeplan?
Ich bekam eine Anfrage vom Schulhaus Lachenzelg, um dort zum Thema «Lügen» mit meinen «Lügengeschichten“ eine Lesung zu machen. Ich finde es immer schön, wenn Schulen ihrem Schulprogramm eine persönliche Note geben, also sagte ich zu. Ich freue mich auf den Anlass und bin gespannt, was die Schüler von sich aus einbringen! Ja, und dann fand ich einfach: Also wenn ich schon in Höngg bin, dann machen wir doch für die Erwachsenen auch noch etwas, am Abend. So kam das dann über das Forum Höngg ins Rollen.
In «Drei Engel» stehen Herr Steinberger und Emil gemeinsam auf der Bühne. Was erwartet das Publikum an diesem Abend? Ein Nutzungskonflikt auf der Bühne?
Den Konflikt hatte ich tatsächlich, aber nur bezüglich des Begriffs «Lesung“. Das ist für viele abschreckend. Sie sagen sich: «Lesung? Nein danke, das kann ich ja selber.» Aber wenn ich lese, dann erzähle ich, so wie ich bin. Und dabei liefert mir Emil die nötige Mimik, er ist einfach mit dabei, es ist ein Paket, Emil und Steinberger sind eins geworden. Emil steht nicht mehr alleine auf der Bühne. Früher habe ich mich umgezogen, habe Hüte und Brillen aufgesetzt und alles verändert. Heute ist das, wohl dem Alter angepasst, eine Form, die ich mir nicht mehr vorstellen kann. Ich wollte ja auch nie mehr ein neues Programm machen. So ist es nun aber einfach organisch gewachsen und hat eine Form angenommen, wie ich sie mir früher nie vorstellen konnte – das finde ich einfach schön und es funktioniert gewaltig.
Letzte Frage: Im Entlebuch gibt es offenbar die nicht gerade schmeichelhafte Redewendung «Du chunsch öppe vo Höngg», haben Sie davon schon mal etwas gehört?
Ja, das kannte ich bereits zu Schulzeiten. Das ist eigenartig! Nur schon das Wort «Höngg» ist doch verrückt (spricht es einige Male aus, betont es verschieden). Woher kommt dieses Wort? Hat es eine Anstalt gegeben, eine Psychiatrie? Vielleicht war es ja auch alleine das Wort «Höngg» – kennt niemand den Ursprung dieser Redewendung? Das ist eigenartig!
Wie dem auch sei, Herr Steinberger: Unser Gespräch war alles andere als eigenartig. Herzlichen Dank und viel Erfolg vor Höngger Publikum.
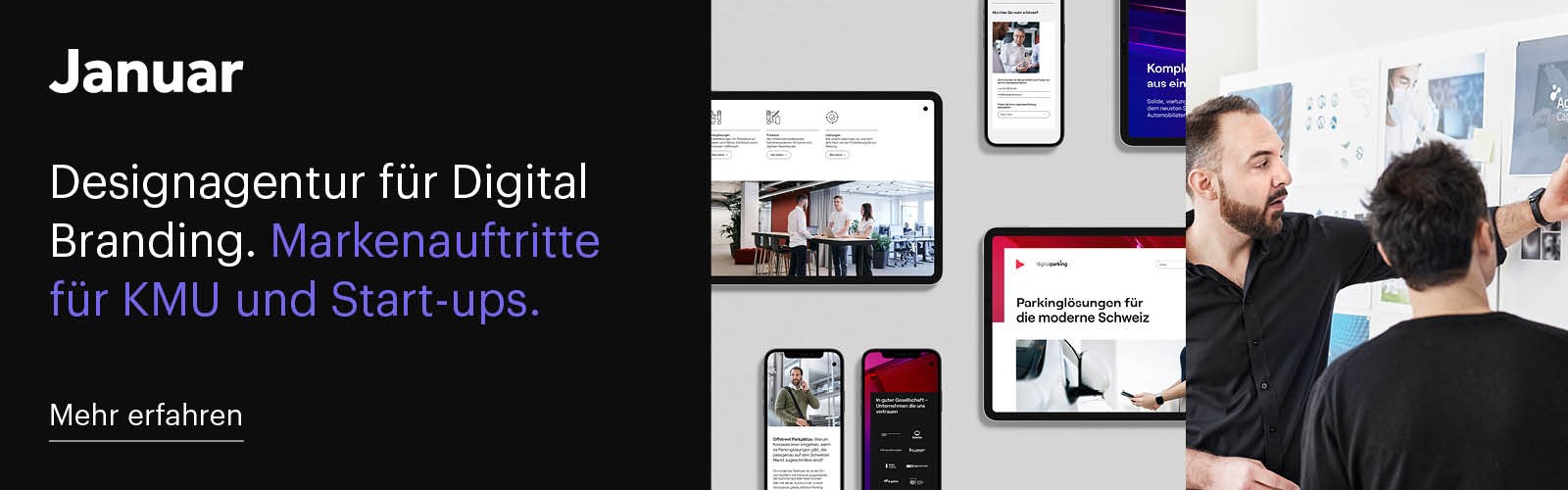



0 Kommentare